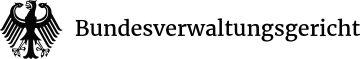Verfahrensinformation
Weitergewährung von Personal und Räumlichkeiten für ehemaligen Bundeskanzler
Der Kläger war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der beklagten Bundesrepublik Deutschland. Im November 2012 fasste der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages den Beschluss, dass zukünftige Bundespräsidenten und Bundeskanzler nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt ihre Büros in Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages erhalten und ihnen Personal zur Verfügung steht (eine Stelle der Wertigkeit B 6, eine Planstelle der Wertigkeit B 3, eine Stelle mit der Wertigkeit E 14 und eine Stelle mit der Wertigkeit E 8). Bis zum Sommer 2022 standen dem Kläger dementsprechend Personal und Räumlichkeiten (sieben von der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages bereitgestellte Räume) zur Verfügung. Mitte Mai 2022 stellte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages fest, dass der Kläger keine fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt mehr wahrnehme, und stellte das Büro des Klägers deshalb ruhend. Ferner forderte der Haushaltsausschuss die Bundesregierung auf, sicherzustellen, dass die Amtsausstattung ehemaliger Bundeskanzler nach der fortwirkenden Verpflichtung aus dem Amt erfolgt und nicht statusbezogen. In Umsetzung dieses Beschlusses sind in dem früheren Büro des Klägers keine Mitarbeiter der Beklagten mehr beschäftigt. Das Bundeskanzleramt forderte den Kläger auf, die amtlichen Unterlagen des Büros des Klägers an das Bundeskanzleramt zu übergeben.
Im August 2022 hat der Kläger mit dem Antrag Klage erhoben, die Beklagte, vertreten durch das Bundeskanzleramt, zu verurteilen, die Ruhendstellung seines Büros aufzuheben und ihm das Büro mit der bisherigen Sach- und Stellenausstattung auch zukünftig zur Verfügung zu stellen, hilfsweise festzustellen, dass die Ruhendstellung rechtswidrig sei. Der Kläger hat dabei ausdrücklich hervorgehoben, es gehe nicht um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit, sondern um bloße Verfahrenshandlungen des Haushaltsschusses und des Bundeskanzleramtes im administrativen Vollzug ihrer Aufgaben und nicht in der Funktion als Hilfsorgan eines Verfassungsorgans. Da es an einer gesetzlichen Grundlage fehle, könne er sich für seinen Anspruch auf die Staatspraxis in Verbindung mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung und entstandenem Gewohnheitsrecht berufen.
Das VG Berlin hat die Klage abgewiesen, das OVG Berlin hat auch die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, der Kläger könne weder aus Gewohnheitsrecht noch aus dem Gleichheitssatz einen Anspruch ableiten. Das Gewohnheitsrecht entstehe erst durch längere tatsächliche, gleichmäßige und allgemeine Übung, die von den Beteiligten als verbindliche Rechtsnorm anerkannt werde. Insbesondere fehle es hier an der erforderlichen Anerkennung durch die Beteiligten, dass der Übung eine verbindliche Rechtsnorm zugrunde liege. Der Kläger könne sich auch nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen. Der Umfang der für die früheren Bundeskanzler eingerichteten und ausgestatteten Büros sei sehr uneinheitlich. Auch stelle die Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers für die Unterhaltung von Büros für aus dem Amt geschiedene Bundeskanzler eine rein an dem öffentlichen Interesse einer angemessenen Erfüllung öffentlicher Aufgaben orientierte staatliche Organisationsentscheidung dar und keine Begünstigung der früheren Amtsinhaber. Die Möglichkeit der Nutzung des Büros sei für frühere Bundeskanzler lediglich ein bloßer Rechtsreflex.
Pressemitteilung Nr. 28/2025 vom 10.04.2025
Klärung eines Anspruchs auf Zurverfügungstellung eines Büros für einen Bundeskanzler a.D. obliegt nicht den Verwaltungsgerichten
Der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten ist nicht eröffnet, wenn ein ehemaliger Bundeskanzler und die Bundesrepublik Deutschland um die personelle und sachliche Ausstattung eines Büros zur Wahrnehmung von nachwirkenden Aufgaben aus der früheren Stellung als Verfassungsorgan streiten. Es handelt sich um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Der Kläger war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. In den Jahren 2006 bis 2021 stellte der Bund dem Kläger im Bundeshaushalt Personal für ein Büro zur Verfügung, darunter eine Stelle mit der Wertigkeit der Besoldungsgruppe B 6. Dies entspricht im Grundsatz einer Übung, die sich in der Staatspraxis der letzten 50 Jahre entwickelt hat. Im Mai 2022 stellte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages auf Antrag der Fraktionen der Ampelkoalition fest, dass der Kläger keine fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt als Bundeskanzler mehr wahrnehme und das Büro deshalb ruhend gestellt werden solle. Der Bundestag beschloss den Haushaltsplan für das Jahr 2022 in Bezug auf die Personalausstattung des Büros in der vom Haushaltsausschuss vorgeschlagenen Fassung. Auch aufgrund der Haushaltspläne für die Jahre 2023 und 2024 stand dem Kläger kein Personal des Bundes mehr zur Verfügung.
Die vom Kläger vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bundesrepublik Deutschland erhobene Klage, ihm das Büro mit der bisherigen Sach- und Stellenausstattung auch zukünftig zur Verfügung zu stellen, hat das Gericht als unbegründet abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht hat auch die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Es handele sich nicht um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit, weil der Kläger kein konkretes Tätigwerden des Haushaltsgesetzgebers erstrebe. Der Kläger leite den Anspruch auf die Ausstattung des Büros vielmehr aus Gewohnheitsrecht und dem Gleichbehandlungsgrundsatz ab. Die Klage sei aber unbegründet, weil sich hieraus kein Anspruch des Klägers ergebe.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision des Klägers gegen das Berufungsurteil zurückgewiesen. Zwar verletzt das Berufungsurteil revisibles Recht, weil es in der Sache über den Anspruch entschieden hat. Das Urteil ist jedoch aus anderen Gründen im Ergebnis richtig. Die Klage ist abzuweisen, weil für die Entscheidung über den geltend gemachten Anspruch auf Zurverfügungstellung eines Büros für einen Bundeskanzler a.D. der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten nicht eröffnet ist. Streitigkeiten über spezifisch verfassungsrechtliche Rechte und Pflichten oberster Staatsorgane sind nicht der Fachgerichtsbarkeit zugewiesen, ihre Entscheidung obliegt ausschließlich dem Bundesverfassungsgericht. Dies betrifft auch die Frage, ob und ggf. welche nachwirkenden Aufgaben oder Verpflichtungen der frühere Amtsträger hat und welche Ausstattung hierfür ggf. geboten ist. Hierfür kommt allein eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts in Betracht.
BVerwG 2 C 16.24 - Urteil vom 10. April 2025
Vorinstanzen:
VG Berlin, VG 2 K 238/22 - Urteil vom 04. Mai 2023 -
OVG Berlin-Brandenburg, OVG 10 B 34/23 - Urteil vom 06. Juni 2024 -
Urteil vom 10.04.2025 -
BVerwG 2 C 16.24ECLI:DE:BVerwG:2025:100425U2C16.24.0
Ausschluss des Verwaltungsrechtswegs bei Streit um die Ausstattung des Büros eines früheren Bundeskanzlers mit Haushaltsmitteln des Bundes
Leitsatz:
Bei einer Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Bundestag und einem früheren Bundeskanzler um die in Form eines Parlamentsgesetzes getroffene Entscheidung, ob und inwieweit dem früheren Amtsinhaber Haushaltsmittel des Bundes zur Wahrnehmung nachwirkender Verpflichtungen aus dem früheren Amt zuzuweisen sind, handelt es sich um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit, sodass der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO nicht eröffnet ist.
-
Rechtsquellen
GG Art. 65, 69, 94, 110 VwGO § 40 Abs. 1 Satz 1, § 88 GVG § 17a Abs. 5 BHO § 3 -
Instanzenzug
VG Berlin - 04.05.2023 - AZ: 2 K 238/22
OVG Berlin-Brandenburg - 06.06.2024 - AZ: 10 B 34/23
-
Zitiervorschlag
BVerwG, Urteil vom 10.04.2025 - 2 C 16.24 - [ECLI:DE:BVerwG:2025:100425U2C16.24.0]
Urteil
BVerwG 2 C 16.24
- VG Berlin - 04.05.2023 - AZ: 2 K 238/22
- OVG Berlin-Brandenburg - 06.06.2024 - AZ: 10 B 34/23
In der Verwaltungsstreitsache hat der 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2025 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Kenntner, die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. von der Weiden und Dr. Hartung, die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Schübel-Pfister und den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Hissnauer für Recht erkannt:
- Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 6. Juni 2024 wird zurückgewiesen.
- Der Kläger trägt die Kosten des Revisionsverfahrens.
Gründe
I
1 Gegenstand des Verfahrens ist die Personal- und Sachausstattung des Büros eines ehemaligen Bundeskanzlers aus Haushaltsmitteln des Bundes.
2 Der Kläger war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Im Anschluss hieran wurde ihm bis zum Jahr 2021, wie auch anderen früheren Bundeskanzlern nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt, für ein Büro durch den jeweils vom Bundestag beschlossenen Haushaltsplan Personal des Bundes zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden dem Kläger jeweils eine Stelle mit der Wertigkeit AT B 6, E 14, E 12, E 9a sowie E 5 zugewiesen; die Stellen waren im Haushaltsplan jeweils mit dem Vermerk "kw mit Wegfall der Aufgabe" versehen. Die insgesamt sieben Büroräume stellte ihm die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag aus dem ihr von der Bundestagsverwaltung zugewiesenen Raumkontingent zur Verfügung.
3 Am 19. Mai 2022 stellte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags fest, dass der Kläger keine fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt mehr wahrnehme, und stellte das Büro des Klägers ruhend. Entsprechend den Empfehlungen seines Haushaltsausschusses strich der Deutsche Bundestag im Haushaltsplan 2022 beim Kläger die Stellen AT B 6 und E 14 und beschloss, dass die übrigen Stellen zwar beibehalten werden, die Stelleninhaber jedoch andere Aufgaben außerhalb des Büros des Klägers wahrnehmen sollen. Auch für die Jahre 2023 und 2024 stand dem Kläger kein Personal des Bundes zur Verfügung.
4 Vor dem Verwaltungsgericht hat der Kläger mit dem Antrag Klage erhoben, ihm das Büro mit der bisherigen Sach- und Stellenausstattung auch zukünftig zur Verfügung zu stellen, hilfsweise festzustellen, dass die Ruhendstellung rechtswidrig ist. Es liege keine verfassungsrechtliche Streitigkeit vor, weil es um Verfahrenshandlungen des Haushaltsausschusses und des Bundeskanzleramts im administrativen Vollzug ihrer Aufgaben und nicht in der Funktion als Hilfsorgan eines Verfassungsorgans gehe. Der Anspruch auf Fortführung der Personal- und Sachausstattung des Büros ergebe sich aus der langjährig geübten Staatspraxis der Beklagten. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt:
5 Es handele sich nicht um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit, weil es dem Kläger nicht um ein konkretes Tätigwerden des Haushaltsgesetzgebers gehe. Die Klage richte sich gegen die Körperschaft Bundesrepublik Deutschland und nicht gegen ein Verfassungsorgan oder einen am Verfassungsleben Beteiligten. Ein Tätigwerden des Haushaltsgesetzgebers strebe der Kläger nicht an. An dieses Klagebegehren sei das Gericht gebunden und es sei nicht dazu berufen, über den verfassungsrechtlichen Charakter eines Anspruchs zu entscheiden, der vom Kläger ersichtlich nicht zum Streitgegenstand gemacht worden sei. Die Klage sei aber unbegründet, weil weder aus Gewohnheitsrecht noch aus dem Gleichheitssatz ein Anspruch darauf bestehe, dass die Beklagte dem Kläger ein Büro mit der bisherigen Sach- und Personalausstattung zur Verfügung stelle.
6
Hiergegen richtet sich die bereits vom Oberverwaltungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassene Revision des Klägers, mit der er beantragt,
die Urteile des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 6. Juni 2024 und des Verwaltungsgerichts Berlin vom 4. Mai 2023 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger das Büro mit der bisherigen Sach- und Stellenausstattung (sieben Büroräume im Gebäude des Bundestags mit Ausstattung, Personalstellen: eine Stelle AT B 6, eine Stelle E 12, eine Stelle E 9a und eine Stelle E 5) auch zukünftig zur Verfügung zu stellen,
hilfsweise festzustellen, dass die Ruhendstellung des Büros des Bundeskanzlers a. D. Schröder auf Grundlage des Haushaltsbeschlusses zu TOP 45 vom 19. Mai 2022, ihm bekanntgegeben mit Schreiben des Bundeskanzleramts vom 10. Juni 2022, rechtswidrig war.
7
Die Beklagte verteidigt das angegriffene Berufungsurteil und beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
II
8 Die Revision des Klägers ist unbegründet. Zwar verletzt das Berufungsurteil mit seinen Ausführungen zur Bindung an die vom Kläger geltend gemachten Klagegründe sowie der Annahme der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Die Revision ist aber nach § 144 Abs. 4 VwGO zurückzuweisen, weil sich die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts aus anderen Gründen als im Ergebnis richtig darstellt.
9 Ungeachtet der Bejahung des Verwaltungsrechtswegs durch die beiden Vorinstanzen hat das Bundesverwaltungsgericht darüber zu entscheiden, ob für die vom Kläger gestellten Anträge die Voraussetzungen des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO gegeben sind (1.). Zu Unrecht hat sich das Oberverwaltungsgericht bei der Prüfung des Verwaltungsrechtswegs an die rechtlichen Ausführungen des Klägers gebunden gesehen. Eine Bindung besteht nach § 88 VwGO nur im Hinblick auf das erkennbare Ziel der Klage, nicht aber in Bezug auf die geltend gemachten Klagegründe tatsächlicher oder rechtlicher Art (2.). Für die vom Kläger gestellten Anträge ist der Verwaltungsrechtsweg nicht eröffnet, weil es sich um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit handelt (3.).
10 1. Der Umstand, dass die beiden Vorinstanzen den Verwaltungsrechtsweg für gegeben erachtet haben, bindet das Revisionsgericht nicht. Denn § 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 17a Abs. 5 GVG, wonach das Gericht, das über ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung in der Hauptsache entscheidet, nicht prüft, ob der beschrittene Rechtsweg zulässig ist, findet auf das Verhältnis zwischen der Verwaltungs- und der Verfassungsgerichtsbarkeit keine Anwendung (BVerwG, Urteil vom 26. März 2025 - 6 C 6.23 - NVwZ 2025, 856 Rn. 14 und Beschluss vom 24. Mai 2024 - 5 BN 2.23 - juris Rn. 12 zu § 17a Abs. 1 GVG). Unter Rechtsweg im Sinne der Regelung ist lediglich die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Fachgerichtsbarkeiten untereinander zu verstehen (Sodan, in: Sodan/Ziekow, Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Aufl. 2018, § 40 Rn. 183a; Wöckel, in: Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 40 Rn. 17).
11 2. Innerhalb des vom Kläger definierten Streitgegenstands haben die Verwaltungsgerichte die Rechtslage umfassend und ohne Bindung an den Vortrag der Beteiligten zu prüfen.
12 Das Berufungsgericht hat es als möglich angesehen, dass der Kläger einen verfassungsrechtlich geprägten Anspruch eines Bundeskanzlers a. D. aus einer nachwirkenden verfassungsrechtlichen Stellung seines früheren Amtes gegen den Haushaltsgesetzgeber geltend macht. Es hat sich aber an der entsprechenden Prüfung gehindert gesehen, weil es an die vom Kläger vorgetragenen Gründe für die geltend gemachten Ansprüche gebunden sei. Dem Kläger gehe es nicht um einen solchen verfassungsrechtlichen Anspruch und er ziele gerade nicht auf ein Tätigwerden des Haushaltsgesetzgebers ab. Über den verfassungsrechtlichen Charakter des Anspruchs sei gerichtlich nicht zu entscheiden, weil er vom Kläger ersichtlich nicht zum Streitgegenstand gemacht worden sei.
13 Damit verletzt das Berufungsgericht § 88 VwGO. Danach darf das Gericht über das Klagebegehren nicht hinausgehen, ist aber an die Fassung der Anträge nicht gebunden. Eine Bindung besteht für das Gericht nach § 88 VwGO aber nur im Hinblick auf das Klagebegehren, d. h. an das erkennbare Ziel der Klage, nicht aber in Bezug auf die geltend gemachten Klagegründe tatsächlicher oder rechtlicher Art. Der Kläger kann weder verlangen, dass einzelne entscheidungserhebliche Elemente des Sachverhalts außer Betracht zu bleiben haben, noch kann er das Gericht in der Entscheidungsfindung auf die Prüfung bestimmter Rechtsgrundlagen beschränken (BVerwG, Urteil vom 13. Juli 2000 - 2 C 34.99 - BVerwGE 111, 318 <320> und Beschluss vom 24. Oktober 2006 - 6 B 47.06 - Buchholz 442.066 § 24 TKG Nr. 1 Rn. 13; Clausing/Kimmel, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Stand: August 2024, § 121 VwGO Rn. 57). Das Gericht kann vielmehr im Rahmen des Streitgegenstands der Klage auch aus anderen Gründen als denjenigen stattgeben, die vom Kläger geltend gemacht worden sind (Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 30. Aufl. 2024, § 88 Rn. 5).
14 3. Bei dem Streit zwischen einem früheren Bundeskanzler und der Bundesrepublik Deutschland um die vom Deutschen Bundestag regelmäßig im Haushaltsplan beschlossene Ausstattung eines Büros des Bundeskanzlers a. D. mit Personal und Sachmitteln des Bundes, um dem Bundeskanzler a. D. die Erfüllung der von ihm wahrgenommenen nachwirkenden Aufgaben oder Pflichten aus seiner früheren Stellung als Verfassungsorgan zu ermöglichen, handelt es sich um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit. Damit ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO nicht eröffnet.
15 a) Das Verständnis des Begriffs der verfassungsrechtlichen Streitigkeit hat sich gewandelt.
16 In älteren Entscheidungen hat das Bundesverwaltungsgericht für die Annahme einer verfassungsrechtlichen Streitigkeit eine sogenannte doppelte Verfassungsunmittelbarkeit gefordert, wonach nicht nur der Streitgegenstand, sondern auch die Beteiligten des Rechtsstreits dem Verfassungsrecht zuzuordnen sein müssen. Danach gehören zu den von der Rechtswegzuweisung des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO ausgenommenen verfassungsrechtlichen Streitigkeiten nur solche Prozesse, die die Rechtsbeziehungen von Verfassungsorganen oder am Verfassungsleben beteiligten Organen zueinander betreffen, nicht hingegen Streitigkeiten zwischen Bürger und Staat, selbst wenn ein Verfassungsorgan daran beteiligt ist (BVerwG, Urteile vom 28. Oktober 1970 - 6 C 55.68 - BVerwGE 36, 218 <228>, vom 28. November 1975 - 7 C 53.73 - NJW 1976, 637 und vom 2. Juli 1976 - 7 C 71.75 - BVerwGE 51, 69 <71>).
17 Dagegen wird in der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur noch auf den materiellen Gehalt der Streitigkeit abgestellt. Eine verfassungsrechtliche Streitigkeit liegt danach vor, wenn das streitige Rechtsverhältnis entscheidend vom Verfassungsrecht geformt ist (BVerwG, Urteile vom 24. Januar 2007 - 3 A 2.05 - BVerwGE 128, 99 Rn. 15 m. w. N., vom 27. Februar 2019 - 6 C 1.18 - BVerwGE 164, 368 Rn. 13 m. w. N. und vom 26. März 2025 - 6 C 6.23 - NVwZ 2025, 856 Rn. 20; ebenso z. B. Ehlers/Schneider, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Stand: August 2024, § 40 VwGO Rn. 138 ff.; Ruthig, in: Kopp/Schenke, VwGO, 30. Aufl. 2024, § 40 Rn. 32a; Wöckel, in: Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 40 Rn. 21, 27; Sodan, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018, § 40 Rn. 195; Haack, in: Gärditz, VwGO, 2. Aufl. 2018, § 40 Rn. 120; Wysk, in: Wysk, Verwaltungsgerichtsordnung, 4. Aufl. 2025, § 40 Rn. 90; anderer Ansicht: Reimer, in: Posser/Wolff/Decker, BeckOK VwGO, Stand: April 2025, § 40 Rn. 102; Würtenberger/Heckmann, Verwaltungsprozessrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 213).
18 Der Wortlaut des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO enthält keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Begriff der verfassungsrechtlichen Streitigkeit nur Rechtsverhältnisse zwischen Verfassungsrechtssubjekten erfasst. Die systematische Auslegung ist ebenfalls unergiebig. Jedenfalls seit der Einführung der Verfassungsbeschwerde (nunmehr Art. 94 Abs. 1 Nr. 4a GG) fehlt der auf die Zeit der Weimarer Republik zurückgehenden Formel von der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit, die im Kern zu einer Gleichsetzung der verfassungsrechtlichen Streitigkeit mit der verfassungsrechtlichen Organstreitigkeit führt, eine argumentative Grundlage (vgl. Ehlers/Schneider, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Stand: August 2024, § 40 VwGO Rn. 139; Sodan, in: Sodan/Ziekow, Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Aufl. 2018, § 40 Rn. 195). Den Gesetzesmaterialien zu § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist nur zu entnehmen, dass die Verfassungsstreitigkeiten von der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit deshalb ausgenommen wurden, weil "diese meist besonderen Gerichten (Bundesverfassungsgericht, Verfassungsgericht oder Staatsgerichtshof der Länder) übertragen" seien (vgl. den Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 5. Dezember 1957 zu der damals noch als § 38 enthaltenen Regelung, BT-Drs. 3/55, S. 30).
19 Entscheidend ist der Zweck der Regelung. Der Sinn des Ausschlusses des Verwaltungsrechtswegs für verfassungsrechtliche Streitigkeiten besteht darin zu gewährleisten, dass das Handeln und die Willensbildung oberster Staatsorgane in Wahrnehmung ihrer spezifischen verfassungsrechtlichen Rechte und Pflichten keiner fachgerichtlichen, sondern ausschließlich der verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt (vgl. Ehlers/Schneider, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Stand: August 2024, § 40 VwGO Rn. 140, 150; Unruh, in: Fehling/Kastner/Störmer, Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2021, § 40 VwGO Rn. 161; Wysk, in: Wysk, Verwaltungsgerichtsordnung, 4. Aufl. 2025, § 40 Rn. 87). Maßgeblich ist, ob es im Kern des Rechtsstreits um das staatsorganisationsrechtliche Können, Dürfen oder Müssen eines Verfassungsrechtssubjekts als solches, d. h. gerade um dessen besondere verfassungsrechtliche Funktionen und Kompetenzen geht (vgl. Ehlers/Schneider, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Stand: August 2024, § 40 VwGO Rn. 151; Sodan in: Sodan/Ziekow, Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Aufl. 2018, § 40 Rn. 215 f.; Unruh, in: Fehling/Kastner/Störmer, Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2021, § 40 VwGO Rn. 161; Wöckel, in: Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 40 Rn. 21).
20 Dass § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO dieses Regelungsziel zugrunde liegt, folgt aus der Entscheidung des Grundgesetzes für die Einführung einer eigenständigen Verfassungsgerichtsbarkeit mit dem Bundesverfassungsgericht als einem den anderen Verfassungsorganen gegenüber selbstständigen und unabhängigen Gerichtshof des Bundes (Art. 93 Abs. 1 GG). Bereits vor der seit dem 28. Dezember 2024 geltenden Neufassung wurde Art. 93 GG insoweit als Grundsatznorm verstanden (vgl. Voßkuhle, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 93 Rn. 1; Walter, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand: August 2024, Art. 93 Rn. 1 ff.). Wie das Bundesverfassungsgericht in der Denkschrift zu seiner Stellung selbst hervorgehoben hat, unterscheidet sich die Verfassungsgerichtsbarkeit von jeder anderen Gerichtsbarkeit (z. B. der Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichtsbarkeit) grundsätzlich dadurch, dass sie allein es mit einer besonderen Art von Rechtsstreitigkeiten, nämlich den "politischen" Rechtsstreitigkeiten, zu tun hat. Unter politischen Rechtsstreitigkeiten seien dabei solche Rechtsstreitigkeiten zu verstehen, bei denen über politisches Recht gestritten und das Politische selbst an Hand der bestehenden Normen zum Gegenstand der richterlichen Beurteilung gemacht werde (BVerfG, Denkschrift, JöR n. F. Bd. 6 <1957>, 144 f.; vgl. hierzu auch Voßkuhle, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 93 Rn. 27). Über die Anwendung und Auslegung der Normen, die Grundlage und Rahmen für das Handeln der politischen Kräfte sind, soll gerade das Bundesverfassungsgericht entscheiden (Roellecke, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. III, 3. Aufl. 2005, § 67 Rn. 12); ihm allein obliegt die Entscheidungskompetenz, wenn Staatsorganisationsrecht als Sonderrecht der Verfassungsrechtssubjekte im Streit steht. Das einfachgesetzliche Verwaltungsprozessrecht würde diese verfassungsrechtliche Grundsatzentscheidung für ein auf die Wahrung der spezifischen Rechte und Pflichten der Staatsorgane und anderen Verfassungsrechtssubjekte bezogenes Kontrollmonopol des Bundesverfassungsgerichts unterlaufen, wenn es die Zuständigkeit für diesen verfassungsrechtlichen Kernbereich den Verwaltungsgerichten übertragen würde (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. März 2025 - 6 C 6.23 - NVwZ 2025, 856 Rn. 22 f.).
21 b) Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei der Auseinandersetzung um die vom Deutschen Bundestag in Form eines Gesetzes getroffene Entscheidung, ob und inwieweit einem Bundeskanzler a. D. im Hinblick auf seine frühere Stellung als Verfassungsorgan (z. B. Art. 65 Abs. 1 GG) Haushaltsmittel des Bundes zur Verfügung zu stellen sind, damit dieser die von ihm wahrgenommenen nachwirkenden Aufgaben oder Verpflichtungen aus seinem früheren Amt erfüllen kann, um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit.
22 aa) Der Kläger war während des gerichtlichen Verfahrens durchgehend darum bemüht, die Handlungen der beklagten Bundesrepublik auf die Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags vom 19. Mai 2022 zur "Ruhendstellung seines Büros" zu reduzieren und seinen gezielt gegen das Bundeskanzleramt gerichteten Anspruch ausschließlich auf die Staatspraxis in Verbindung mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung und entstandenem Gewohnheitsrecht zu stützen. Diese Beschränkung wird den rechtlichen Vorgaben für die Verwendung von Haushaltsmitteln des Bundes für die personelle und sachliche Ausstattung des Büros eines früheren Verfassungsorgans im Hinblick auf nachwirkende Aufgaben oder Pflichten nicht gerecht. Denn es geht um jeweils auf bestimmte natürliche Personen bezogene Entscheidungen des Deutschen Bundestags in Gesetzesform. Dies gilt sowohl für die Jahre 2006 bis 2021, in denen der Deutsche Bundestag dem Kläger Personal des Bundes im jeweiligen Haushaltsplan zugewiesen hat, als auch für die Jahre ab 2022, in denen das Parlament dem Kläger solche Mittel ausdrücklich versagt hat.
23 Seit dem Jahr 2006, dem ersten Haushaltsjahr nach dem Ende der Amtszeit des Klägers als Bundeskanzler nach Art. 69 Abs. 2 GG, bis zum Jahr 2021 beruhte die Zuweisung von Personal des Bundes für ein Büro auf einer auf die konkrete Person des jeweiligen früheren Bundeskanzlers bezogenen Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers im Haushaltsplan. So waren etwa für die Tätigkeit bei dem im Jahr 2017 verstorbenen ehemaligen Bundeskanzler Dr. Kohl im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 - Einzelplan 04 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt - noch zwei Stellen mit der Wertigkeit E 12 ausgewiesen. Auch für das Büro des Klägers war in diesem Einzelplan für das Haushaltsjahr 2021 (S. 135) jeweils eine Stelle mit der Wertigkeit AT B 6, E 14, E 12, E 9a sowie E 5 zugewiesen.
24 Der Entwurf der Bundesregierung für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2022 (BT-Drs. 20/1000 S. 147) sah für den Kläger noch die bisherige Stellenzuweisung vor. Im Anschluss an seinen Beschluss vom 19. Mai 2022 zur Ruhendstellung des Büros des Klägers formulierte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags die Empfehlung, dass beim Kläger die AT B 6 sowie die Stelle E 14 gestrichen werden, die übrigen Stellen zwar beibehalten werden und die Stelleninhaber jedoch andere Aufgaben außerhalb des Büros des Klägers wahrnehmen sollten (BT-Drs. 20/1626 S. 18 sowie BT-Drs. 20/1628 S. 17). Der Deutsche Bundestag beschloss den Gesetzentwurf eines Haushaltsgesetzes 2022 in der vom Haushaltsausschuss vorgeschlagenen Fassung (BT, Plenarprotokoll 20/42 S. 4196). Dementsprechend sah der Haushaltsplan für das Jahr 2022 für den Kläger im Einzelplan 04 (S. 139) kein Personal des Bundes mehr vor, das im Büro des Klägers tätig werden sollte. Demgegenüber wies der Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2022 der im Herbst 2021 aus dem Amt ausgeschiedenen früheren Bundeskanzlerin Dr. Merkel insgesamt neun Stellen zu (zwei Stellen B 6, eine Stelle A 15, eine Stelle A 9m, eine Stelle E 14, eine Stelle E 12, eine Stelle E 11 und zwei Stellen E 5). Die Haushaltspläne der Jahre 2023 und 2024 entsprachen hinsichtlich der personellen Ausstattung des Büros des Klägers dem Haushaltsplan für das Jahr 2022.
25 An diese, auf die Person des Klägers bezogenen Vorgaben der vom Deutschen Bundestag beschlossenen Haushaltspläne war die Beklagte mit der Folge gebunden, dass ihre Behörden dem Kläger - ungeachtet eines etwaigen Gewohnheitsrechts eines früheren Bundeskanzlers oder eines Anspruchs aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung - kein Personal des Bundes zur Verfügung stellen durften. Dies folgt aus der durch das Grundgesetz vorgegebenen Funktion des Haushaltsplans, der zusammen mit dem Haushaltsgesetz eine Einheit bildet (BVerfG, Urteil vom 19. Juli 1966 - 2 BvF 1/65 - BVerfGE 20, 56 <92 f.> und Beschluss vom 22. Oktober 1974 - 1 BvL 3/72 - BVerfGE 38, 121 <125 f.>).
26 Nach Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GG wird der Haushaltsplan des Bundes für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Der Haushaltsplan ist die verbindliche Grundlage der Politik der Bundesregierung für das betreffende Rechnungsjahr und Maßstab für die Kontrolle des Haushalts durch das Parlament. Das Budgetrecht des Deutschen Bundestags und dessen haushaltspolitische Gesamtverantwortung sind als unverfügbarer Teil des grundgesetzlichen Demokratieprinzips durch Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 und Art. 79 Abs. 3 GG geschützt. Es gehört zum änderungsfesten Kern von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, dass der Bundestag dem Volk gegenüber verantwortlich über alle wesentlichen Einnahmen und Ausgaben entscheidet und über die Summe der Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sowie über wesentliche Ausgaben des Staates befindet (vgl. BVerfG, Urteile vom 30. Juli 2019 - 2 BvR 1685/14 u. a. - BVerfGE 151, 202 Rn. 123 und vom 6. Dezember 2022 - 2 BvR 547/21 u. a. - BVerfGE 164, 193 Rn. 134 m. w. N.). Das Haushaltsgesetz ist ein formelles Gesetz, das seine Rechtswirkungen nur im organschaftlichen Rechtskreis zwischen Parlament und Regierung entfaltet. Es ist darauf beschränkt, die Exekutive zur Leistung der veranschlagten Ausgaben zu ermächtigen (vgl. § 3 Abs. 1 BHO); wegen des Fehlens unmittelbarer Außenwirkung werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (vgl. § 3 Abs. 2 BHO) (vgl. BVerfG, Beschluss vom 16. Dezember 1980 - 2 BvR 419/80 - BVerfGE 55, 349 <362> und Urteil vom 18. April 1989 - 2 BvF 1/82 - BVerfGE 79, 311 <327>).
27 Der Haushaltsplan ermächtigt die Regierung, die betreffenden Mittel für die vom Parlament festgelegten Zwecke auszugeben. Daraus folgt, dass die Exekutive beim Vollzug des Haushaltsplans die dort niedergelegten Zweckbestimmungen, Vermerke und Erläuterungen zu beachten hat (BVerfG, Urteil vom 19. Juli 1966 - 2 BvF 1/65 - BVerfGE 20, 56<91> m. w. N.; Leibholz/Rinck, Grundgesetz, Art. 110, Rn. 3; Heun, in: Dreier, Grundgesetz, Bd. III, 3. Aufl. 2018, Art. 110 Rn. 29; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 110 Rn. 15; Drüen, in: Voßkuhle/Huber, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 110 Rn. 67; Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand: August 2024, Art. 110 Rn. 65). Die sachliche Bindung kommt auch in § 45 Abs. 1 Satz 1 BHO zum Ausdruck, wonach Ausgaben nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, und nur bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet werden dürfen. Da es sich bei dem Haushaltsplan als Teil des Haushaltsgesetzes um ein Gesetz - allerdings mit einem speziellen Regelungsgehalt - handelt, bindet er auch die Gerichte (Siekmann, in: Sachs, GG, 10. Aufl. 2024, Art. 110 Rn. 25 m. w. N.; Heun, in: Dreier, Grundgesetz, Bd. III, 3. Aufl. 2018, Art. 110 Rn. 29; Heintzen, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz, 7. Aufl. 2021, Art. 110 Rn. 37).
28 bb) Die Entscheidung über die vom Kläger gestellten Klageanträge setzt zunächst die Klärung voraus, ob und ggf. welche nachwirkenden Aufgaben oder Pflichten einem früheren Bundeskanzler nach seinem Ausscheiden aus dem Amt als Verfassungsorgan noch obliegen. Ferner ist darüber zu befinden, welche personellen und sachlichen Mittel des Bundes erforderlich sind, um dem früheren Amtsinhaber die Wahrnehmung dieser Aufgaben oder Pflichten zu ermöglichen. Geboten ist ferner eine Entscheidung, ob das Ausmaß dieser Bundesmittel z. B. von der Amtsdauer als Verfassungsorgan abhängen soll und ob die Unterstützung durch den Bund auf Lebenszeit zu gewähren oder mit der Zeit zu reduzieren und schließlich einzustellen ist. Sollte der Kläger nach Maßgabe dieser Entscheidungen grundsätzlich noch personelle und sachliche Bundesmittel beanspruchen können, ist zu klären, ob die zur Einstellung der Unterstützung führende Annahme des Deutschen Bundestags zutrifft, der Kläger habe ab Juni 2022 keine fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt mehr wahrgenommen, und ob die vom Haushaltsgesetzgeber ab dem Jahr 2022 praktizierte unterschiedliche Behandlung des Klägers gegenüber der früheren Bundeskanzlerin Dr. Merkel gerechtfertigt werden kann.
29 Diese Fragen betreffen im Kern das staatsorganisationsrechtliche Können, Dürfen oder Müssen von Verfassungsrechtssubjekten im Verhältnis zueinander, hier einerseits ein früherer Bundeskanzler, bei dem die Zuweisung von Personal des Bundes in der Staatspraxis aus seiner früheren Stellung als Verfassungsorgan abgeleitet wird, und andererseits der Deutsche Bundestag, der über die Verwendung der Bundesmittel entscheidet und der seit nahezu 50 Jahren früheren Amtsinhabern regelmäßig lebenslang Personal des Bundes zuweist. Gestritten wird damit um besondere verfassungsrechtliche Funktionen und Kompetenzen, deren Klärung als "politische" Streitigkeiten den Verfassungsgerichten obliegt.
30 (1) Nach dem Wortlaut des Grundgesetzes enden die verfassungsrechtlichen Pflichten eines Bundeskanzlers spätestens mit der Ernennung seines Nachfolgers (Art. 69 Abs. 3 GG). Bis dahin ist der Bundeskanzler nach dem Zusammentritt eines neu gewählten Bundestags auf Ersuchen des Bundespräsidenten verpflichtet, die Geschäfte weiterzuführen. Obwohl das Grundgesetz einem früheren Bundeskanzler für den Zeitraum nach der Ernennung seines Nachfolgers keine ausdrücklichen Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt, wird in der Staatspraxis von der Existenz solcher nachwirkenden Rechte und Verpflichtungen eines früheren Bundeskanzlers ausgegangen, die sich aus seiner früheren Stellung als Verfassungsorgan ableiten.
31 Seit 1967 - beginnend mit dem im Sommer 1966 zurückgetretenen zweiten Bundeskanzler Dr. Ehrhard - sehen die jeweiligen Haushaltspläne des Bundes vor, dass ehemaligen Bundeskanzlern persönlich Personal des Bundes zugewiesen wird. Die jeweilige Bundesregierung, die zur Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans verpflichtet ist (vgl. Art. 110 Abs. 3 GG), hat entsprechende Zuweisungen in ihrem Entwurf vorgesehen; der Deutsche Bundestag hat die Zuweisungen jeweils im Haushaltsplan beschlossen. Im November 2012 fasste der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags den Beschluss, dass die personelle Ausstattung eines Bundeskanzlers nach seinem Ausscheiden eine Planstelle B 6, eine Planstelle B 3, eine Stelle E 14 sowie eine Stelle E 8 umfassen soll (vgl. Bericht des Bundesrechnungshofs über die Versorgung und Ausstattung der ehemaligen Bundespräsidenten, Bundeskanzler und Bundestagspräsidenten, Teilprüfung Bundeskanzler, vom 18. September 2018, S. 8 ff. und 33). Der früheren Bundeskanzlerin Dr. Merkel sind im Haushaltsplan für das Jahr 2024 insgesamt neun Stellen zugewiesen.
32 Diese seit nahezu 50 Jahren bestehende staatsrechtliche Praxis der Beklagten der Zuweisung von Personalstellen ist von Anfang an mit der "Erledigung der mit dem früheren Amt zusammenhängenden Aufgaben" oder mit der "Abwicklung fortwirkender Verpflichtungen" begründet worden (vgl. Bericht des Bundesrechnungshofs über die Versorgung und Ausstattung der ehemaligen Bundespräsidenten, Bundeskanzler und Bundestagspräsidenten, Teilprüfung Bundeskanzler, vom 18. September 2018, S. 8 ff.). Auch in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage vom 12. Januar 2022 (BT-Drs. 20/397 S. 2) hat die Bundesregierung ausgeführt, es entspreche einer langjährigen Staatspraxis, Bundeskanzlern a. D. ein Büro zur Verfügung zu stellen, um diese bei der Erfüllung der nachwirkenden Amtspflichten zu unterstützen. Der das Verfahren zur Einstellung der Unterstützung des Klägers einleitende Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags vom 19. Mai 2022 knüpft ebenfalls an die dem Kläger als Bundeskanzler a. D. obliegenden fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt an. Denn er stellt fest, dass der Kläger eine solche fortwirkende Verpflichtung nicht mehr wahrnehme (Ziff. 1 des Beschlusses), und begründet damit die Ruhendstellung des Büros des Klägers. Die beiden im parlamentarischen Verfahren gescheiterten Initiativen zur gesetzlichen - stark einschränkenden - Regelung der Amtsausstattung ehemaliger Amtsinhaber zur Erledigung fortwirkender Amtsaufgaben eines ehemaligen Bundeskanzlers gingen ebenfalls von der Existenz solcher Verpflichtungen aus (vgl. BT-Drs. 19/10759 S. 5 und BT-Drs. 20/1540 S. 3). Zu Beginn der 20. Legislaturperiode hat der Hauptausschuss des Deutschen Bundestags in seiner Eigenschaft als Haushaltsausschuss die Zuweisung von Personal und Sachmitteln an die ehemalige Bundeskanzlerin Dr. Merkel mit der "Wahrnehmung von im Bundesinteresse liegenden Aufgaben" begründet, die aus "fortwirkenden amtlichen Pflichten" resultieren. Das Auswärtige Amt stellt Bundeskanzlern a. D. regelmäßig einen Diplomatenpass aus, um dem früheren Amtsinhaber Reisen, die dieser nach Abschluss der Dienstzeit im amtlichen Auftrag oder im besonderen deutschen Interesse unternimmt, überhaupt erst zu ermöglichen oder wesentlich zu erleichtern (§ 4 Abs. 5 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Ausstellung amtlicher Pässe der Bundesrepublik Deutschland).
33 Im gerichtlichen Verfahren hat auch der Kläger seinen Anspruch auf unveränderte Zuweisung von Personal des Bundes stets damit begründet, er nehme fortwirkende Aufgaben oder Verpflichtungen aus seinem früheren Amt als Bundeskanzler wahr, und hat dafür konkrete Beispiele angeführt. Die Beklagte ist im gerichtlichen Verfahren ebenfalls davon ausgegangen, dass ein Bundeskanzler a. D. im Hinblick auf seine frühere Stellung als Verfassungsorgan damit betraut werden kann, für die Beklagte bestimmte öffentliche Aufgaben wahrzunehmen.
34 (2) Haushaltsmittel dürfen nur zur Bewältigung öffentlicher Aufgaben verwendet werden. Diese einfachrechtlich in § 6 BHO zum Ausdruck kommende Beschränkung schließt es aus, dass Personal des Bundes dazu herangezogen wird, um ehemalige Bundeskanzler bei erwerbswirtschaftlichen Tätigkeiten - z. B. für private Unternehmen –, bei der Wahrnehmung von Aufsichts- und Verwaltungsratsmandaten, bei der Lobbyarbeit für bestimmte Interessengruppen oder bei der Erledigung privater Angelegenheiten - z. B. Abwicklung von Bauarbeiten in einer privaten Liegenschaft des ehemaligen Bundeskanzlers - zu unterstützen (vgl. zur Praxis in den Jahren 2013 bis 2015, Bericht des Bundesrechnungshofs vom 18. September 2018, Teilprüfung Bundeskanzler, S. 11 f.).
35 Die Eingrenzung und genaue Festlegung der "nachwirkenden Aufgaben und Verpflichtungen" eines früheren Amtsinhabers, für deren Erfüllung öffentliche Mittel des Bundes in Gestalt von Personalstellen zugewiesen werden dürfen, ist aber nicht Sache der Fachgerichte.
36 (3) Ausgehend von dieser Festlegung der nachwirkenden Aufgaben oder Verpflichtungen eines Bundeskanzlers a. D., deren Wahrnehmung die Zuweisung von Haushaltsmitteln rechtfertigt, sind die Personalstellen zu bestimmen, die für die Erledigung dieser Aufgaben als erforderlich angesehen werden. Auch diese Festlegung im Verhältnis zwischen einem Bundeskanzler a. D. und dem Deutschen Bundestag als dem für die Zuweisung von Haushaltsmitteln zuständigen Verfassungsorgan ist nicht Aufgabe der Fachgerichte.
37 (4) Die Ausgestaltung der Zuweisung von Personal des Bundes durch den jeweiligen Haushaltsplan kann auch davon abhängig gemacht werden, wie lange der betreffende Bundeskanzler als Verfassungsorgan amtiert hat. Davon unabhängig ist zu entscheiden, ob das Personal - wie bisher üblich - dem früheren Amtsinhaber lebenslang zur Verfügung steht oder die Zuweisung zu befristen ist.
38 Die bei der Einführung der Ausstattung früherer Bundeskanzler ins Auge gefasste zeitliche Begrenzung der Zuweisung von Bundesmitteln an einen früheren Amtsinhaber wurde bereits 1967 wieder fallen gelassen. Die beiden gescheiterten Versuche, die Ausstattung eines ehemaligen Bundeskanzlers zur Erledigung der fortwirkenden Verpflichtungen durch eine Ergänzung des Bundesministergesetzes zu regeln, sahen ebenfalls die Befristung der Unterstützung auf fünf und vier Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Amt vor (Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs. 19/10759 und Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, BT-Drs. 20/1540).
39 cc) Durch den Ausschluss des Verwaltungsrechtswegs ist der Kläger auch nicht rechtsschutzlos gestellt. Denn er kann den von ihm auf die Staatspraxis und den Grundsatz der Gleichbehandlung mit anderen früheren Amtsinhabern gestützten Anspruch auf Zuweisung insbesondere von Personal des Bundes zur Erledigung nachwirkender Aufgaben und Pflichten aus dem Amt vor dem Bundesverfassungsgericht in einem gegen den Deutschen Bundestag geführten Organstreitverfahren (Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 GG) geltend machen. Die Frist des § 64 Abs. 3 BVerfGG beginnt mit der Bekanntgabe des jeweiligen Haushaltsplans.
40 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.