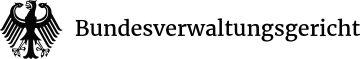Verfahrensinformation
Gerichtliche Kontrolle bei Stellenbesetzung durch Wahl
Der Kläger bewarb sich neben fünf weiteren Personen, darunter der Beigeladene, bei der beklagten baden-württembergischen Stadt auf die Stelle des Ersten Beigeordneten. Die Wahl des Gemeinderats im Dezember 2020 fiel mit 15 Stimmen auf den Beigeladenen, der bis zu diesem Zeitpunkt bereits Leiter des ausgeschriebenen Geschäftsbereichs gewesen war. Der Kläger erhielt keine, ein weiterer Bewerber sieben Stimmen. Über den Ausgang der Wahl wurde der Kläger sofort in Kenntnis gesetzt. Einen Tag nach der Wahl bestellte die Beklagte den Beigeladenen zum Ersten Beigeordneten und übergab ihm die Ernennungsurkunde.
Hiergegen hat der Kläger im Januar 2021 Widerspruch sowie im Juli 2021 Klage erhoben. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Berufungsgericht das Urteil des Verwaltungsgerichts geändert und die Ernennung des Beigeladenen zum Ersten Beigeordneten der Beklagten aufgehoben. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, die Besetzung der Stelle mit dem Beigeladenen verletze den Kläger in seinem Bewerbungsverfahrensanspruch aus Art. 33 Abs. 2 GG. Zwar sei die eigentliche Wahl des Beigeordneten einer gerichtlichen Kontrolle entzogen. Die Ausgestaltung des Stellenbesetzungsverfahrens unterliege indes einer gerichtlichen Überprüfung. Im vorliegenden Fall sei die Grenze zur unzulässigen Voreingenommenheit und damit zur Rechtswidrigkeit des Auswahlverfahrens überschritten, weil schon bei der Schaffung und Ausgestaltung der Beigeordnetenstelle für die Mehrheit des Gemeinderats festgestanden habe, dass der Beigeladene die Stelle erhalten solle. Da die Beklagte die Ernennung vorgenommen habe, ohne dem Kläger ausreichend Zeit zur Wahrnehmung gerichtlichen Rechtsschutzes zu geben, greife der Grundsatz der Ämterstabilität nicht.
Mit ihrer vom Berufungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassenen Revision wendet sich die Beklagte gegen die berufungsgerichtliche Entscheidung.
Pressemitteilung Nr. 27/2025 vom 10.04.2025
Eingeschränkte gerichtliche Kontrolle bei Wahl von hauptamtlichen kommunalen Beigeordneten
Der verfassungsrechtliche Grundsatz der Bestenauswahl aus Art. 33 Abs. 2 GG vermittelt einem Bewerber bei der Wahl eines Beigeordneten durch den Gemeinderat einen gerichtlich überprüfbaren Anspruch auf chancengleiche Ausgestaltung des Bewerbungsverfahrens. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Der Kläger bewarb sich neben fünf weiteren Personen, darunter der Beigeladene, bei der beklagten baden-württembergischen Stadt für die Stelle des Ersten Beigeordneten. Der Gemeinderat wählte mit 15 Stimmen den Beigeladenen, der Kläger erhielt keine, ein weiterer Bewerber sieben Stimmen. Über den Ausgang der Wahl wurde der Kläger unmittelbar im Anschluss informiert. Einen Tag später bestellte die Beklagte den Beigeladenen unter Aushändigung der Ernennungsurkunde zum Ersten Beigeordneten.
Hiergegen hat der Kläger im Folgemonat Widerspruch und später Klage erhoben. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Berufungsgericht die Ernennung des Beigeladenen zum Ersten Beigeordneten aufgehoben. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Besetzung der Stelle mit dem Beigeladenen verletze den Kläger in seinem aus Art. 33 Abs. 2 GG folgenden Bewerbungsverfahrensanspruch. Zwar sei die eigentliche Wahl des Beigeordneten einer gerichtlichen Kontrolle entzogen. Die Ausgestaltung des Stellenbesetzungsverfahrens unterliege aber einer gerichtlichen Überprüfung. Im vorliegenden Fall sei die Grenze zur unzulässigen Voreingenommenheit und damit zur Rechtswidrigkeit des Auswahlverfahrens überschritten. Schon bei der Schaffung und Ausgestaltung der Stelle des Beigeordneten habe für die Mehrheit des Gemeinderats festgestanden, dass der Beigeladene die Stelle erhalten solle.
Das Bundesverwaltungsgericht hat auf die Revision der Beklagten das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Zwar beruht die Wahl zum Beigeordneten auf einem Akt demokratischer Willensbildung, weshalb der Wahlakt selbst einer inhaltlichen Kontrolle durch die Gerichte entzogen ist. Aus Art. 33 Abs. 2 GG ergibt sich aber ein Anspruch des Bewerbers auf chancengleiche Ausgestaltung der der Wahl vorgelagerten Verfahrensschritte. Verfahrensgestaltungen, die ohne sachlichen Grund eine unterschiedliche Behandlung des Bewerberfeldes vorsehen, verletzen den Bewerbungsverfahrensanspruch des benachteiligten Bewerbers. Die Einhaltung des Gebots der Chancengleichheit ist von den Gerichten auch daraufhin zu überprüfen, ob in der Person des (Mit-)Bewerbers gesetzlich bestimmte Voraussetzungen für das Wahlamt vorliegen und ob er ein etwaig zwingendes Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle erfüllt.
Ausgehend hiervon hat die Beklagte den Anspruch des Klägers auf chancengleiche Ausgestaltung des Bewerbungsverfahrens nicht verletzt. Aus dem Zuschnitt der neu geschaffenen Stelle eines Beigeordneten lässt sich grundsätzlich noch keine "Voreingenommenheit" des Gemeinderats ableiten. Auch eine auf (kommunal-)politischen Erwägungen beruhende Willensbildung im Gemeinderat ist nicht zu beanstanden, wenn die formalen Anforderungen an ein rechtsstaatliches und dem Grundsatz der Chancengleichheit entsprechendes Verfahren gewahrt werden.
BVerwG 2 C 12.24 - Urteil vom 10. April 2025
Vorinstanzen:
VG Sigmaringen, VG 2 K 2218/21 - Urteil vom 30. März 2023 -
VGH Mannheim, VGH 4 S 1511/23 - Urteil vom 23. April 2024 -
Urteil vom 10.04.2025 -
BVerwG 2 C 12.24ECLI:DE:BVerwG:2025:100425U2C12.24.0
Leitsatz:
Wahl und Ernennung von kommunalen Beigeordneten unterliegen nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Da die Wahl auf einem Akt demokratischer Willensbildung beruht, ist der Wahlakt selbst einer inhaltlichen Kontrolle durch die Gerichte entzogen. Aus Art. 33 Abs. 2 GG ergibt sich aber ein Anspruch der Bewerber auf chancengleiche Ausgestaltung der der Wahl vorgelagerten Verfahrensschritte.
-
Rechtsquellen
GG Art. 33 Abs. 2 GemO BW §§ 18, 50 LVwVfG BW §§ 20, 21 -
Instanzenzug
VG Sigmaringen - 30.03.2023 - AZ: 2 K 2218/21
VGH Mannheim - 23.04.2024 - AZ: 4 S 1511/23
-
Zitiervorschlag
BVerwG, Urteil vom 10.04.2025 - 2 C 12.24 - [ECLI:DE:BVerwG:2025:100425U2C12.24.0]
Urteil
BVerwG 2 C 12.24
- VG Sigmaringen - 30.03.2023 - AZ: 2 K 2218/21
- VGH Mannheim - 23.04.2024 - AZ: 4 S 1511/23
In der Verwaltungsstreitsache hat der 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2025 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Kenntner, die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. von der Weiden und Dr. Hartung, die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Schübel-Pfister und den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Hissnauer für Recht erkannt:
- Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 23. April 2024 wird aufgehoben.
- Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom 30. März 2023 wird zurückgewiesen.
- Der Kläger trägt die Kosten des Berufungs- und des Revisionsverfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, die dieser selbst trägt.
Gründe
I
1 Der Rechtsstreit betrifft den Umfang der gerichtlichen Prüfbefugnis bei der Wahl eines hauptamtlichen kommunalen Beigeordneten.
2 Der 19.. geborene Kläger bewarb sich - neben fünf weiteren Personen - bei der beklagten baden-württembergischen Stadt auf die Stelle des Ersten Beigeordneten. Dem Bewerberfeld gehörte auch der Beigeladene an, der zu diesem Zeitpunkt bereits Leiter des im Wesentlichen unverändert ausgeschriebenen Geschäftsbereichs war. Nachdem ein Teil der Bewerber − darunter der Kläger − Gelegenheit erhielten, sich und ihre Bewerbung persönlich vorzustellen, wählte der Gemeinderat im Dezember 2020 mit 15 Stimmen den Beigeladenen, der Kläger erhielt keine Stimme, ein weiterer Bewerber sieben Stimmen. Über den Ausgang der Wahl wurde der Kläger unmittelbar im Anschluss informiert. Einen Tag später bestellte die Beklagte den Beigeladenen unter Aushändigung der Ernennungsurkunde zum Ersten Beigeordneten.
3 Hiergegen hat der Kläger im Folgemonat Widerspruch und später Klage erhoben. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Berufungsgericht die Ernennung des Beigeladenen zum Ersten Beigeordneten aufgehoben. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Besetzung der Stelle mit dem Beigeladenen verletze den Kläger in seinem aus Art. 33 Abs. 2 GG folgenden Bewerbungsverfahrensanspruch. Zwar sei die Wahl des Beigeordneten selbst einer gerichtlichen Kontrolle entzogen. Die Ausgestaltung des Stellenbesetzungsverfahrens unterliege aber gerichtlicher Überprüfung. Im vorliegenden Fall sei die Grenze zur unzulässigen Voreingenommenheit und damit zur Rechtswidrigkeit des Auswahlverfahrens überschritten. Schon bei Schaffung und Ausgestaltung der Stelle des Beigeordneten habe für die Mehrheit des Gemeinderats festgestanden, dass der Beigeladene die Stelle erhalten solle. Dies folge aus dem Aufgabenzuschnitt der ausgeschriebenen Stelle sowie dem Umstand, dass von vornherein nur die Haushaltsmittel vorgesehen worden seien, die für eine Umwandlung der bereits vom Beigeladenen versehenen Hauptamtsleiterstelle in ein Beigeordnetenamt erforderlich seien.
4 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision macht die Beklagte geltend, bei einer Stellenbesetzung durch Wahl bestehe lediglich ein Anspruch des Einzelnen auf Chancengleichheit im Verfahren. Zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Gründen sich ein Mitglied des Gemeinderats für einen Bewerber entscheide, sei als Teil der Wahlentscheidung gerichtlich nicht überprüfbar.
5
Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 23. April 2024 aufzuheben und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom 30. März 2023 zurückzuweisen.
6
Der Kläger beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
7 Er trägt vor, sein Bewerbungsverfahrensanspruch sei durch die unzulässige Vorfestlegung der Mehrheitsfraktionen des Gemeinderats auf den Beigeladenen verletzt worden.
8 Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt.
II
9 Die zulässige Revision der Beklagten ist begründet. Das Berufungsurteil verletzt revisibles Recht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 und § 191 Abs. 2 VwGO, § 127 Nr. 2 BRRG und § 63 Abs. 3 Satz 2 BeamtStG). Das Berufungsgericht hat die Klage im Ergebnis zwar zutreffend als zulässig angesehen (1.), sie ist jedoch unbegründet (2.). Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass Art. 33 Abs. 2 GG, der auf die chancengleiche Ausgestaltung der der Wahl vorgelagerten Verfahrensschritte gerichtet ist, auch dem Bewerber um das Amt eines hauptamtlichen kommunalen Beigeordneten einen Bewerbungsverfahrensanspruch vermittelt (a). Die Annahme, dessen Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall erfüllt, trifft aber nicht zu (b).
10 1. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht die Zulässigkeit der ursprünglich als Untätigkeitsklage erhobenen Klage bejaht (a). Die Klage ist auch im Übrigen zulässig, weil das erforderliche Rechtsschutzinteresse gegeben ist (b). Die Wahl des Klägers im Falle der erneuten Durchführung ist ernstlich möglich (c).
11 a) Die Untätigkeitsklage des Klägers war mit Ablauf der Drei-Monats-Frist im April 2021 und folglich zum Zeitpunkt ihrer Erhebung am 23. Juli 2021 auch ohne das nach Maßgabe des § 126 Abs. 3 BRRG i. V. m. §§ 68 f. VwGO durchzuführende Vorverfahren zulässig, weil es an einem zureichenden Grund für den verzögerten (und letztlich unterbliebenen) Erlass eines Widerspruchsbescheids fehlte (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. März 1973 - 4 C 2.72 - BVerwGE 42, 108 <109 ff.>; s. a. BVerwG, Urteil vom 11. Juli 2018 - 1 C 18.17 - BVerwGE 162, 331 Rn. 14).
12 Ein zureichender Grund (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. Juli 2018 - 1 C 18.17 - BVerwGE 162, 331 Rn. 16), über den Widerspruch des Klägers nicht zu entscheiden, lag insbesondere nicht deshalb vor, weil der Kläger den Widerspruch entgegen seiner anderslautenden Ankündigung nicht begründet hat. Die Begründung des Widerspruchs ist kein Formerfordernis i. S. d. §§ 68 f. VwGO. An einem zureichenden Grund fehlt es mithin jedenfalls dann, wenn der anwaltlich vertretene Widerspruchsführer lediglich pauschal ohne zeitliche Eingrenzung die Vorlage einer Begründung bzw. einer "ergänzenden Stellungnahme" ankündigt. In diesem Fall besteht für die Behörde kein Anlass, vom Grundsatz der zügigen Durchführung des (Widerspruchs-)Verfahrens abzusehen (§ 79 Halbs. 2 i. V. m. § 10 Satz 2 LVwVfG BW). Sie ist jedenfalls gehalten, eine Frist zur Nachholung der angekündigten Begründung zu setzen. Die an den Kläger gerichtete Aufforderung der Beklagten, den Widerspruch zu begründen, erfolgte erst im Juni 2021 und damit zu einem Zeitpunkt, zu dem ein zureichender Grund für die verzögerte Entscheidung über den Widerspruch bereits nicht mehr vorlag.
13 b) Der Kläger verfügt zudem über das erforderliche Rechtsschutzinteresse.
14 Die Ernennung des Beigeladenen zum Ersten Beigeordneten kann trotz des Grundsatzes der Ämterstabilität noch rückgängig gemacht werden. Die Beklagte hat nach Mitteilung des Wahlergebnisses nicht eine angemessene Zeit zugewartet, um dem Kläger die Möglichkeit zu geben, gerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Sie hat den Kläger durch die Aushändigung der Ernennungsurkunde an den Beigeladenen am Tag nach der Wahl vielmehr unter Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG an der Ausschöpfung seiner Rechtsschutzmöglichkeiten gehindert (vgl. BVerwG, Urteile vom 4. November 2010 - 2 C 16.09 - BVerwGE 138, 102 Rn. 17 ff., vom 22. September 2016 - 2 C 16.15 - Buchholz 310 § 44a VwGO Nr. 13 Rn. 27 und vom 13. Dezember 2018 - 2 A 5.18 - BVerwGE 164, 84 Rn. 22 ff. m. w. N.).
15 Der Kläger kann folglich im Wege der kombinierten Anfechtungs- und Verpflichtungsklage weiterhin sein grundrechtsgleiches Recht auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung in die Bewerberauswahl (vgl. BVerwG, Beschluss vom 26. März 2024 - 2 VR 10.23 - BVerwGE 182, 59 Rn. 19 m. w. N.; s. a. BVerwG, Urteil vom 4. November 2010 - 2 C 16.09 - BVerwGE 138, 102 Rn. 16) geltend machen, weil bei einer Aufhebung der Ernennung des Beigeladenen das Verfahren zur Wahl eines hauptamtlichen kommunalen Beigeordneten wieder auflebt, sofern und solange das (Aus-)Wahlverfahren nicht gegenstandslos geworden ist (vgl. BVerwG, Urteile vom 3. Dezember 2014 - 2 A 3.13 - BVerwGE 151, 14 Rn. 16, 19 und vom 12. Oktober 2023 - 2 A 5.22 - NVwZ-RR 2024, 197 Rn. 19).
16 c) Die Wahl des Klägers bei einer erneuten Durchführung des Verfahrens erscheint auch ernstlich möglich.
17 Der 19.. geborene Kläger hat weder gegenwärtig noch im Zeitpunkt der zu erwartenden Wiederholungswahl das 68. Lebensjahr vollendet. Er erfüllt damit (weiterhin) die gesetzlich vorgesehenen Bestellungsvoraussetzungen (§ 50 Abs. 1a GemO BW). Die Einschätzung der Beklagten, der Kläger sei im Fall der Wahlwiederholung in jedem Falle chancenlos, weil er nach dem erfolgreichen Berufungsurteil versucht habe, den Rechtsstreit unstreitig gegen eine Ausgleichszahlung zu beenden, ist spekulativ. Sie trägt dem Umstand nicht hinreichend Rechnung, dass die Bestellung des kommunalen Beigeordneten auf geheimer Wahl beruht und der Willensbildungsprozess daher weder vorherbestimmt ist noch vorgesehen werden kann.
18 2. Die Revision der Beklagten hat jedoch Erfolg, denn die Klage ist unbegründet.
19 Wahl und Ernennung von kommunalen Beigeordneten unterliegen nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Da die Wahl auf einem Akt demokratischer Willensbildung beruht, ist der Wahlakt selbst einer inhaltlichen Kontrolle durch die Gerichte entzogen. Aus Art. 33 Abs. 2 GG ergibt sich aber ein Anspruch der Bewerber auf chancengleiche Ausgestaltung der der Wahl vorgelagerten Verfahrensschritte (a). Die hieraus folgenden Anforderungen hat die Beklagte nicht verletzt (b).
20 a) Der Besonderheit der auf Wahl beruhenden Bestellung kommunaler Wahlbeamter ist auch im Rahmen der Anwendung des Art. 33 Abs. 2 GG Rechnung zu tragen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. September 2016 - 2 BvR 2453/15 - BVerfGE 143, 22 Rn. 21).
21 aa) Nach Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Danach sind öffentliche Ämter nach Maßgabe des Grundsatzes der Bestenauswahl zu besetzen. Die von Art. 33 Abs. 2 GG erfassten Auswahlentscheidungen können grundsätzlich nur auf Gesichtspunkte gestützt werden, die unmittelbar Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Bewerber betreffen. Dabei dient Art. 33 Abs. 2 GG zum einen dem öffentlichen Interesse an der bestmöglichen Besetzung des öffentlichen Dienstes. Zum anderen trägt Art. 33 Abs. 2 GG dem berechtigten Interesse der Beamten an einem angemessenen beruflichen Fortkommen dadurch Rechnung, dass er ein grundrechtsgleiches Recht auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung in die Bewerberauswahl begründet (sog. Bewerbungsverfahrensanspruch, vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 16. Dezember 2015 - 2 BvR 1958/13 - BVerfGE 141, 56 Rn. 31 m. w. N. und vom 20. September 2016 - 2 BvR 2453/15 - BVerfGE 143, 22 Rn. 18; BVerwG, Urteil vom 9. Mai 2019 - 2 C 1.18 - BVerwGE 165, 305 Rn. 31; Beschluss vom 26. März 2024 - 2 VR 10.23 - BVerwGE 182, 59 Rn. 19). Demnach besitzt Art. 33 Abs. 2 GG eine objektiv-rechtliche Dimension, gewährt aber auch ein grundrechtsgleiches Recht, das sich vor allem durch die Gestaltung des Auswahlverfahrens verwirklicht (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. September 2016 - 2 BvR 2453/15 - BVerfGE 143, 22 Rn. 17).
22 Hierbei ist zu gewärtigen, dass das Berufsbeamtentum und seine Regelungen auf den Lebenszeitbeamten ausgerichtet sind (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 30. März 1977 - 2 BvR 1039/75 - BVerfGE 44, 249 <262 f.> und vom 28. Mai 2008 - 2 BvL 11/07 - BVerfGE 121, 205 <220 f.>). Der Grundsatz der lebenszeitigen Übertragung aller statusrechtlichen Ämter gilt jedoch nicht ausnahmslos. Bestimmte Beamtenverhältnisse sind traditionsgemäß aus dem geschützten Kernbereich des Art. 33 Abs. 5 GG herausgenommen und als Durchbrechungen des Lebenszeitprinzips anerkannt (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 24. April 2018 - 2 BvL 10/16 - BVerfGE 149, 1 Rn. 37 und vom 9. April 2024 - 2 BvL 2/22 - BVerwGE 169,67 Rn. 50).
23 Eine anerkannte Ausnahme vom Lebenszeitprinzip ist u. a. der kommunale Wahlbeamte als Beamter auf Zeit. Seine Stellung wird durch seine politische Funktion charakterisiert, die den Grund für die zeitliche Befristung bildet. Seine Berufung erfolgt durch einen Akt demokratischer Willensbildung, der erneuert werden muss, wenn der Beamte nach Ablauf der Wahlperiode im Amt bleiben soll. Die kommunalen Wahlbeamten nehmen innerhalb der Gruppe der Beamten auf Zeit eine besondere Stellung ein (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 28. Mai 2008 - 2 BvL 11/07 - BVerfGE 121, 205 <223> und vom 24. April 2018 - 2 BvL 10/16 - BVerfGE 149, 1 Rn. 40). Der Wahlakt (vgl. auch § 11 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c BeamtStG) als Akt demokratischer, periodisch zu erneuernder Willensbildung ist das bestimmende Sachmerkmal, das den kommunalen Wahlbeamten - Bürgermeister, Landrat oder auch Beigeordneter - von dem Normalfall des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit unterscheidet (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24. April 2018 - 2 BvL 10/16 - BVerfGE 149, 1 Rn. 41 m. w. N.).
24 bb) Diese Besonderheiten sind auch im Rahmen des Art. 33 Abs. 2 GG zu berücksichtigen.
25 Die in Art. 33 Abs. 2 GG normierten Auswahlgrundsätze und der hierauf bezogene Bewerbungsverfahrensanspruch sind auf die Auswahlentscheidung bezogen (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 10. Mai 2016 - 2 VR 2.15 - BVerwGE 155, 152 Rn. 16 und vom 26. März 2024 - 2 VR 10.23 - BVerwGE 182, 59 Rn. 19). Die Verpflichtung, die dem Dienstherrn aus dem Bewerbungsverfahrensanspruch der Bewerber erwächst, trägt demnach zwei Aspekten Rechnung. Der Dienstherr ist während eines laufenden Bewerbungsverfahrens nicht nur zur leistungsgerechten Auswahl, sondern auch zur chancengleichen Behandlung aller Bewerber im Verfahren verpflichtet (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. November 2012 - 2 C 6.11 - BVerwGE 145, 185 Rn. 25; Beschluss vom 26. März 2024 - 2 VR 10.23 - BVerwGE 182, 59 Rn. 22).
26 Da aber die Bestellung des Beigeordneten Ergebnis einer "Auswahlentscheidung" ist, die auf einem Akt demokratischer Willensbildung beruht, ist der Wahlakt selbst einer inhaltlichen Kontrolle durch die Gerichte entzogen. Dies hat auch das Berufungsgericht zutreffend erkannt und hierzu in rechtlich nicht zu beanstandender Weise ausgeführt, dass das Ergebnis der Wahl auch keiner Begründung bedarf.
27 Die Modifikation des Art. 33 Abs. 2 GG bei Wahl und Besetzung entsprechender Ämter auf (staatlicher oder) kommunaler Ebene erstreckt sich jedoch nicht auf das der Wahl vorgelagerte Bewerbungsverfahren.
28 In Konkurrenzsituationen kommt dem Gebot der Chancengleichheit entscheidende Bedeutung zu. Art. 33 Abs. 2 GG beinhaltet das Recht des Einzelnen auf chancengleiche Ausgestaltung des Bewerbungsverfahrens, was die chancengleiche Behandlung aller Bewerber im Verfahren bedingt. Dies schließt es aus, dass der Dienstherr Maßnahmen ergreift, die bei objektiver Betrachtung, d. h. aus der Sicht eines unbefangenen Beobachters, als eine Bevorzugung oder aktive Unterstützung eines Bewerbers erscheinen. Er darf nicht bestimmten Bewerbern Vorteile verschaffen, die andere nicht haben (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. November 2012 - 2 C 6.11 - BVerwGE 145, 185 Rn. 25; Beschlüsse vom 10. Mai 2016 - 2 VR 2.15 - BVerwGE 155, 152 Rn. 25 und vom 26. März 2024 - 2 VR 10.23 - BVerwGE 182, 59 Rn. 22) und muss damit die Chancengleichheit einschränkende, nicht sachlich begründete Vorfestlegungen vermeiden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. August 2024 - 2 BvR 418/24 - NVwZ 2024, 1832 Rn. 27). Auch ein kommunales Wahlorgan ist an das Gebot der Chancengleichheit gebunden.
29 Dieser strikt verfahrensbezogene Gewährleistungsgehalt des Art. 33 Abs. 2 GG ist darauf gerichtet, dem einzelnen Bewerber die Möglichkeit zu eröffnen, das Wahlgremium von seiner Person zu überzeugen. Verfahrensgestaltungen, die ohne sachlichen Grund von der allgemeinen Behandlung des Bewerberfeldes abweichen, verletzen hingegen den Bewerbungsverfahrensanspruch des Einzelnen. Dabei ist unerheblich, ob ein Verstoß gegen das aus Art. 33 Abs. 2 GG resultierende Gebot der Chancengleichheit in Konkurrenzsituationen die Wahl beeinflusst hat, weil diese geheim und die Wahlentscheidung nicht zu begründen ist.
30 Hiermit geht einher, dass den Mitgliedern des kommunalen Wahlgremiums in geeigneter Form die Möglichkeit eingeräumt werden muss, Einsicht in die nach Ausschreibung der Stelle des Beigeordneten (vgl. § 50 Abs. 3 Satz 2 GemO BW) eingegangenen Bewerbungsunterlagen zu nehmen. Trifft das Wahlgremium zudem - wie hier - eine Vorauswahl hinsichtlich derjenigen Bewerber, die für eine persönliche Vorstellung in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats eingeladen werden, hat die Auswahl unter Anwendung sachlicher Kriterien und nach einheitlichen Grundsätzen zu erfolgen. Entsprechendes gilt in Bezug auf Ausgestaltung und Ablauf der Vorstellung der einzelnen Bewerber. Der hiermit korrespondierende Umfang gerichtlicher Kontrollmöglichkeiten schließt auch die Überprüfung mit ein, ob der Gewählte die gesetzlichen Voraussetzungen für das Wahlamt (vgl. § 7 Abs. 1 BeamtStG, § 50 Abs. 1a GemO BW) und ein etwaig zwingendes Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle erfüllt, mithin zur Wahl zuzulassen war.
31 Eine wie auch immer geartete (mittelbare) "Willkürkontrolle" der Wahlentscheidung findet dagegen nicht statt. Mithin verletzt auch die Annahme des Berufungsgerichts, die eigentliche (Aus-)Wahlentscheidung könne daraufhin überprüft werden, ob die anzuwendenden Rechtsbegriffe verkannt, ob von einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen, ob allgemeingültige Wertmaßstäbe außer Acht gelassen oder ob sachwidrige Erwägungen angestellt worden sind (UA S. 17 f.), revisibles Recht. Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung kann - wie sich aus Vorstehendem ergibt - allein die Wahrung des Gebots der Chancengleichheit und damit die Frage sein, ob die anzuwendenden Verfahrensvorschriften beachtet worden sind.
32 b) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts liegt ein Verstoß gegen den Anspruch des Klägers auf chancengleiche Ausgestaltung des Bewerbungsverfahrens und damit eine Verletzung seines Bewerbungsverfahrensanspruchs nicht vor. Einen solchen Verstoß hat das Berufungsgericht im Hinblick auf den vom Kläger geltend gemachten Verfahrensfehler in Gestalt einer "unzureichenden Informationsgrundlage" für die Wahlentscheidung rechtsfehlerfrei verneint (aa). Fehlerhaft ist das Berufungsgericht jedoch von einer den Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers verletzenden Voreingenommenheit der "Mehrheit des Gemeinderats aus Freien Wählern, Grünen und FDP" bzw. von einer "Vorfestlegung der Mehrheitsfraktionen auf den Beigeladenen" ausgegangen (bb).
33 aa) Nach den den Senat revisionsrechtlich bindenden Feststellungen des Berufungsgerichts (vgl. § 137 Abs. 2 VwGO) hatten die Mitglieder des Gemeinderats sowohl in den Gemeinderatssitzungen am 3. und 16. Dezember 2020 als auch im Rathaus die Möglichkeit der Einsichtnahme in die vollständigen Bewerbungsunterlagen. Darüber hinaus erhielten die Gemeinderäte in Bezug auf die drei Bewerber, die sich wie der Kläger persönlich vorstellen durften, zur Sitzung am 16. Dezember 2020 eine Tischvorlage bestehend aus dem jeweiligen Anschreiben und den Lebensläufen; zudem hatten die Mitglieder des Gemeinderats Kenntnis davon, dass und welche Bewerbungsunterlagen existierten. Sie hatten außerdem die Möglichkeit, im Rahmen der Vorstellungsrunde Nachfragen zu den einzelnen Kandidaten zu stellen. Des Weiteren waren die Redezeiten der Bewerber zur persönlichen Vorstellung ihrer Dauer nach gleich bemessen.
34 Ein Verstoß gegen den Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers ergibt sich hieraus nicht. Die Ausgestaltung des Bewerbungsverfahrens lässt eine ungleiche Behandlung des Klägers im Vergleich zu den übrigen Bewerbern nicht erkennen.
35 bb) Eine Verletzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs des Klägers liegt auch im Übrigen nicht vor.
36 Die Annahme des Berufungsgerichts einer den Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers verletzenden Voreingenommenheit der "Mehrheit des Gemeinderats aus Freien Wählern, Grünen und FDP" bzw. von einer "Vorfestlegung der Mehrheitsfraktionen auf den Beigeladenen" trägt nicht dem Umstand Rechnung, dass die Rechtsordnung die institutionelle Befangenheit einer "Behörde" nicht kennt. Regelungen über den Ausschluss vom Verfahren und einer Besorgnis der Befangenheit (s. § 20 und § 21 LVwVfG BW, § 18 GemO BW) nehmen vielmehr stets den Einzelnen in den Blick (vgl. BVerwG, Urteile vom 16. Juni 2016 - 9 A 4.15 - Buchholz 407.4 § 17a FStrG Nr. 12 Rn. 29 und vom 3. November 2020 - 9 A 12.19 - juris Rn. 52; Beschluss vom 22. Mai 2024 - 3 B 2.23 - juris Rn. 9).
37 Im Übrigen lässt sich aus dem Zuschnitt der neu geschaffenen Stelle eines Beigeordneten ohne das Hinzutreten weiterer Umstände keine "Voreingenommenheit" herleiten. Er war hier maßgeblich dem Umstand geschuldet, dass der Bürgermeister Änderungen an seiner Zuständigkeit nicht beabsichtigt hatte. Im Übrigen kann die Aufgabenzuteilung der Dienstposten jederzeit geändert werden; sie ist hier nachfolgend tatsächlich auch verändert worden. Entsprechendes gilt für die vom Berufungsgericht herangezogenen Erwägungen zur haushalterischen Belastung der neu geschaffenen Stelle. Abgesehen davon, dass auch insoweit nur auf die Äußerungen einzelner Gemeinderatsmitglieder abgestellt worden ist, wären entsprechende Vorstellungen nicht verbindlich. Auch dies wird durch den Umstand bestätigt, dass die Beklagte nachfolgend die freigewordene Stelle des Beigeladenen tatsächlich wieder besetzt hat.
38 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 und Abs. 3 sowie § 162 Abs. 3 VwGO. Da der Beigeladene keinen Antrag gestellt hat, hat er keine Kosten zu tragen, kann aber billigerweise auch keine Kostenerstattung beanspruchen.