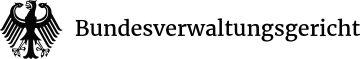Beschluss vom 31.01.2025 -
BVerwG 7 B 20.24ECLI:DE:BVerwG:2025:310125B7B20.24.0
-
Zitiervorschlag
BVerwG, Beschluss vom 31.01.2025 - 7 B 20.24 - [ECLI:DE:BVerwG:2025:310125B7B20.24.0]
Beschluss
BVerwG 7 B 20.24
- OVG Berlin-Brandenburg - 28.09.2023 - AZ: 3a A 4/23
In der Verwaltungsstreitsache hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts
am 31. Januar 2025
durch die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Tegethoff und
Dr. Löffelbein sowie die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Bähr
beschlossen:
Die vom A. und vom Richter am Bundesverwaltungsgericht B. mit dienstlichen Erklärungen vom 27. und 28. Juni 2024 angezeigten Sachverhalte begründen nicht die Besorgnis der Befangenheit.
Gründe
I
1 Die Klägerin und Beschwerdeführerin wird von Herrn Rechtsanwalt C. aus der Kanzlei D. vertreten.
2 Mit dienstlicher Erklärung vom 28. Juni 2024 hat der Senatsvorsitzende A. angezeigt, dass sein Sohn E. seit dem 1. März 2024 als Anwalt in der Kanzlei D. tätig ist. Sein Sohn sei dort allerdings ausschließlich dem Dezernat von Prof. Dr. D. zugewiesen. Für das Dezernat C. arbeite er nicht. Das Senatsmitglied Richter am Bundesverwaltungsgericht B. hat mit dienstlicher Erklärung vom 27. Juni 2024 angezeigt, dass ein anderer Rechtsanwalt aus der Kanzlei D. ihn seit ca. einem Jahr in einem dienstrechtlichen Verfahren vertrete, das noch nicht abgeschlossen sei.
3 Die beigeladene Stadt X wird von F., Lehrstuhlinhaber am Institut für ..., vertreten.
4 Ebenfalls mit dienstlicher Erklärung vom 28. Juni 2024 hat der A. angezeigt, dass er an dem genannten Institut und im Fachbereich von F. als Honorarprofessor tätig ist. Der Kontakt mit dem Lehrstuhl beschränke sich auf organisatorische Unterstützung durch das Sekretariat und einen Tutor im Rahmen seiner Vorlesung.
5 Die Beteiligten hatten Gelegenheit, zu den dienstlichen Äußerungen Stellung zu nehmen. Die Beigeladene hat sich mit Schriftsatz vom 22. August 2024 dahin geäußert, dass ein Grund für die Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern des Senats nicht bestehe. Die übrigen Beteiligten haben von der Möglichkeit zur Stellungnahme keinen Gebrauch gemacht.
II
6 Der Senat entscheidet anlässlich der Selbstanzeige zweier Senatsmitglieder über deren Befangenheit gemäß § 54 Abs. 1 VwGO i. V. m. §§ 48 und 45 Abs. 1 ZPO ohne Mitwirkung der betreffenden Richter in der bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung vorgesehenen Besetzung von drei Richtern (§ 10 Abs. 3 VwGO).
7 Wegen Besorgnis der Befangenheit nach § 42 Abs. 2 ZPO ist ein Richter an der Mitwirkung und Entscheidung eines Streitfalls gehindert, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen. Tatsächliche Befangenheit oder Voreingenommenheit ist nicht erforderlich; es genügt schon der "böse Schein", das heißt der mögliche Eindruck mangelnder Objektivität. Dabei kommen nur objektive Gründe in Betracht, die aus der Sicht eines verständigen Prozessbeteiligten berechtigte Zweifel an der Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit des Richters aufkommen lassen (stRspr, vgl. BVerfG, Beschluss vom 26. Februar 2014 - 1 BvR 471/10 u. a. - BVerfGE 135, 248 Rn. 23). Solche Zweifel können sich aus dem Verhalten des Richters innerhalb oder außerhalb des konkreten Rechtsstreits sowie aus einer besonderen Beziehung des Richters zum Gegenstand des Rechtsstreits oder - wie hier in Rede stehend - zu Prozessbeteiligten ergeben (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 - I ZB 58/17 - NJW 2019, 516 Rn. 10).
8 1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, wenn sein Ehegatte als Rechtsanwalt in der Kanzlei tätig ist, die einen Beteiligten vor diesem Richter vertritt (vgl. BGH, Beschlüsse vom 15. März 2012 - V ZB 102/11 - NJW 2012, 1890 Rn. 9 bis 11 und vom 21. Juni 2018 - I ZB 58/17 - NJW 2019, 516 Rn. 15). Der Bundesgerichtshof hat die Annahme einer Besorgnis der Befangenheit darauf gestützt, bei einer in der Kanzlei des Prozessbevollmächtigten einer Partei als Rechtsanwältin arbeitenden Ehefrau bestehe schon aufgrund der besonderen Nähe des Ehegatten des Richters zu dem Prozessbevollmächtigten die Gefahr, dass der Prozessbevollmächtigte auf die Ehefrau und diese wiederum auf den erkennenden Richter Einfluss nehme. Mithin kann ein Befangenheitsgrund auch in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen des Richters zu einem Mitglied der als Prozessbevollmächtigte auftretenden Rechtsanwaltssozietät liegen (Vollkommer, in: Zöller, ZPO, 35. Aufl. 2024, § 42 ZPO Rn. 12).
9 Nach diesen Maßstäben ist eine Befangenheit des A. wegen der Tätigkeit seines Sohnes als Anwalt in der Kanzlei D. hier nicht zu besorgen. Das Näheverhältnis eines Vaters zu seinem erwachsenen Sohn, der nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung ausweislich des Briefkopfs der Kanzlei an einem anderen Ort, nämlich in Y, tätig ist, ist nicht ohne Weiteres mit dem ehelichen Näheverhältnis zu vergleichen. Zudem besteht die Kanzlei D. in Y aus acht Partnern und im Dezember 2024 aus zwanzig angestellten Rechtsanwälten. Zu dieser größeren Anzahl angestellter Rechtsanwälte gehört seit März 2024 der Sohn des Richters, der dem Dezernat eines Partners, der in dem hiesigen Rechtsstreit nicht auftritt, zugewiesen ist. Diese Konstellation unterscheidet sich auch deutlich von der einer (abgelehnten) Richterin, die noch ein Jahr zuvor in der Kanzlei ihres Vaters, die in dem Rechtsstreit auftrat, anwaltlich tätig war (vgl. OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 23. Mai 2024 - 2 WF 55/24 - NJW 2024, 3382 Rn. 14). Dass hier die nahe Verwandtschaft den Richter dazu bewegen könnte, allein wegen des Arbeitsverhältnisses seines Sohnes der die Klägerin vertretenden großen Rechtsanwaltskanzlei entweder (unbewusst) solidarisch oder - umgekehrt - besonders kritisch zu begegnen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 17. Juni 2024 - 9 C 3.23 - juris Rn. 10), ist nicht ersichtlich.
10 2. Allgemeine geschäftliche oder berufliche Beziehungen und Kontakte des Richters zu dem Prozessbevollmächtigten eines Beteiligten ohne besondere Nähe und Intensität genügen nicht für die Annahme der Befangenheit des Richters (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Juni 2013 - AnwZ (Brfg) 24/12 - NJW-RR 2013, 1211 Rn. 8). Danach geben die in den dienstlichen Erklärungen der beiden Richter mitgeteilten Kontakte im Rahmen einer Honorarprofessur und der Vertretung durch einen anderen Rechtsanwalt einer der hier auftretenden Kanzleien in einem gänzlich anderen Sachgebiet keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit und objektiven Einstellung der Richter zu zweifeln.
11 3. Schließlich haben auch die Beteiligten auf der Grundlage der ihnen bekannten dienstlichen Äußerungen keinen Anlass gesehen, die betroffenen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.
Beschluss vom 05.03.2025 -
BVerwG 7 B 20.24ECLI:DE:BVerwG:2025:050325B7B20.24.0
-
Zitiervorschlag
BVerwG, Beschluss vom 05.03.2025 - 7 B 20.24 - [ECLI:DE:BVerwG:2025:050325B7B20.24.0]
Beschluss
BVerwG 7 B 20.24
- OVG Berlin-Brandenburg - 28.09.2023 - AZ: 3a A 4/23
In der Verwaltungsstreitsache hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts
am 5. März 2025
durch den Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts Prof. Dr. Korbmacher, den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Günther und
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Bähr
beschlossen:
- Die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 28. September 2023 wird zurückgewiesen.
- Die Klägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen.
- Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwerdeverfahren auf 5 000 € festgesetzt.
Gründe
I
1 Die Klägerin begehrt die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz.
2 Das Landesamt für Umwelt hatte der Klägerin unter Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von sechs Windkraftanlagen im Außenbereich des Gemeindegebiets der Beigeladenen erteilt. Die Beigeladene erhob hiergegen Widerspruch, mit dem sie geltend machte, die ausreichende Erschließung des genehmigten Vorhabens sei nicht gesichert. Nachdem ihr Begehren auf Anordnung der sofortigen Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erfolglos geblieben war, beantragte die Klägerin bei der beklagten Behörde, zur Sicherung der Erschließung durch Änderung der ursprünglichen Planung ein ergänzendes Verfahren nach § 7 Abs. 5 Satz 1 UmwRG durchzuführen. Die nach erfolglosem behördlichen Vorverfahren erhobene Klage hat das Oberverwaltungsgericht als unzulässig abgewiesen und die Revision gegen sein Urteil nicht zugelassen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Klägerin.
3 In einem parallel geführten Verfahren hat das Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 11. Oktober 2023 - 3a A 3/23 - die Klage gegen den Widerspruchsbescheid des Beklagten, mit dem die immissionsschutzrechtliche Genehmigung der Klägerin aufgehoben wurde, weil die ausreichende Erschließung des Vorhabens nicht gesichert gewesen sei, abgewiesen. Auch dort hat das Oberverwaltungsgericht die Revision gegen seine Entscheidung nicht zugelassen. Die dagegen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin hat der Senat mit Beschluss vom 5. März 2025 - BVerwG 7 B 19.24 - zurückgewiesen.
II
4 Die auf die Revisionszulassungsgründe der Verfahrensmängel (1.) und der grundsätzlichen Bedeutung (2.) gestützte Beschwerde ist unbegründet.
5 1. Aus dem Vorbringen der Klägerin ergibt sich kein Verfahrensmangel im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO.
6 a) Ein Verstoß gegen die richterliche Hinweispflicht liegt nicht vor. Nach § 86 Abs. 3 VwGO hat der Vorsitzende unter anderem darauf hinzuwirken, dass unklare Anträge erläutert und sachdienliche Anträge gestellt werden. Das Oberverwaltungsgericht hat ausweislich des Sitzungsprotokolls in der mündlichen Verhandlung auf die aus seiner Sicht bestehende "prozessuale Problematik" hingewiesen. In der Verhandlungsniederschrift heißt es, der Klageschrift könne entnommen werden, dass die Klägerin anstelle einer erforderlichen Verpflichtungsklage Anfechtungsklage erhoben habe. Dieser Hinweis war nicht verspätet. Zwar sind nach § 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 139 Abs. 4 Satz 1 ZPO Hinweise so früh wie möglich zu erteilen. Bei Zweifeln an der Zulässigkeit der Klage sollten die entsprechenden Hinweise bereits im vorbereitenden Verfahren ergehen (vgl. Schübel-Pfister, in: Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 86 Rn. 90). Wäre hier jedoch ein Hinweis noch vor der mündlichen Verhandlung erfolgt, hätte dies an der von der Vorinstanz angenommenen Unzulässigkeit der Verpflichtungsklage nach Ablauf der Monatsfrist ab Zustellung des Widerspruchsbescheids (§ 74 Abs. 2, Abs. 1 Satz 1 VwGO), anstatt der - nach ihrer Auslegung des Klagebegehrens (§ 88 VwGO) – erhobenen Anfechtungsklage, nichts mehr ändern können. Die Klage ist erst am letzten Tag des sowohl für eine Anfechtungs- als auch eine Verpflichtungsklage geltenden gesetzlichen Fristablaufs erhoben worden. § 86 Abs. 3 VwGO verpflichtet das Gericht nicht, noch am Tag des Klageeingangs - hier am 5. März 2021 (Freitag) um 15:48 Uhr - das Begehren eines anwaltlich vertretenen Klägers auf seine Zulässigkeit zu überprüfen und die Prozessbevollmächtigten, in der Erwartung, dass diese noch am selben Tag reagieren, entsprechend zu unterrichten. Dies gilt uneingeschränkt dann, wenn, wie im vorliegenden Fall, eine besondere Eilbedürftigkeit für das Gericht nicht ersichtlich war und sich die - aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts - Unzulässigkeit einer Anfechtungsklage auch nicht auf den ersten Blick aufdrängte, sondern eine gründliche Überprüfung der Sach- und Rechtslage erforderte.
7 Soweit die Beschwerde einen weiteren Verstoß gegen die Hinweispflicht darin sieht, dass das Gericht in der mündlichen Verhandlung nicht darauf hingewiesen habe, dass es den von ihm angeratenen Verpflichtungsantrag als verfristet ansehen werde, kann dahinstehen, ob das Gericht tatsächlich auf eine Umformulierung des Antrags "hingewirkt" hat, denn eines solchen Hinweises hätte es angesichts der offensichtlich die Problematik der richtigen Klageart umfassenden Erörterung in der mündlichen Verhandlung überhaupt nicht bedurft. Die Frage der Verfristung einer Verpflichtungsklage musste den Verfahrensbevollmächtigten nach der Erörterung der prozessualen Situation auch ohne einen weiteren richterlichen Hinweis vor Augen stehen. Sie tragen im Übrigen auch mit der Beschwerde nicht vor, was sie bei einem entsprechenden Hinweis und Einräumung einer Stellungnahmefrist zur Frage der Verfristung vorgetragen hätten.
8 b) Die Auslegung des Klagebegehrens durch das Oberverwaltungsgericht führt nicht auf einen Verfahrensmangel. Nach § 88 VwGO darf das Gericht über das Klagebegehren nicht hinausgehen, ist aber an die Fassung der Anträge nicht gebunden. Es hat vielmehr das tatsächliche Rechtsschutzbegehren zu ermitteln. Insoweit sind die für die Auslegung von Willensäußerungen geltenden Grundsätze (§§ 133, 157 BGB) anzuwenden. Für die Auslegung des Klagebegehrens sind neben dem Klageantrag insbesondere die Klagebegründung sowie das gesamte übrige Klagevorbringen zu berücksichtigen, ferner die Interessenlage des Klägers, soweit sie sich aus seinem Vortrag und sonstigen für das Gericht und die übrigen Beteiligten als Empfänger der Prozesserklärung erkennbaren Umständen ergibt. Dem (angekündigten) Klageantrag kommt besondere Bedeutung zu, wenn der Kläger bei der Antragsfassung anwaltlich vertreten ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. April 2018 - 3 C 11.16 - Buchholz 451.74 § 8 KHG Nr. 18 Rn. 14).
9 Nach diesem von ihm zugrunde gelegten Maßstab hat das Oberverwaltungsgericht das Klagebegehren zutreffend erfasst. Aus der mit "Anfechtungsklage" überschriebenen Klageschrift, dem angekündigten Antrag und der Begründung ergibt sich, dass die Klägerin die Aufhebung des die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens nach § 7 Abs. 5 Satz 1 UmwRG versagenden Bescheids in Gestalt des Widerspruchsbescheids erreichen wollte. Auch der nach Ablauf der Klagefrist eingegangenen weiteren Klagebegründung lässt sich nicht entnehmen, dass die Klägerin ein Verpflichtungsbegehren verfolgt hat. Dies ergibt sich insbesondere daraus, worauf auch in dem angegriffenen Urteil zu Recht hingewiesen wird, dass die Klägerin dort zu Beginn ihrer Rechtsausführungen den Wortlaut von § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO zitiert. Zudem bestätigt die Einlassung der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, wonach es ihr Ziel gewesen sei, dass das ergänzende Verfahren nach der Beseitigung des versagenden Bescheids wiederaufgenommen werde, die Auslegung durch das Oberverwaltungsgericht. Dass sie ihr ursprüngliches Anfechtungsbegehren nach wie vor für statthaft gehalten hat, ist auch an der Aufrechterhaltung dieses Antrags als Hilfsantrag erkennbar. Schließlich wird die Interessenlage der Klägerin durch ihr Vorbringen im Parallelverfahren BVerwG 7 B 19.24 , in dem sie den Widerspruchsbescheid anficht, mit dem ihre immissionsschutzrechtliche Genehmigung aufgehoben wurde, deutlich. Dort vertritt sie die Auffassung, dass die ausreichende Erschließung ihres Vorhabens nachträglich in einem ergänzenden Verfahren nach § 7 Abs. 5 Satz 1 UmwRG gesichert werden könne, weshalb die ihr erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung auf den Widerspruch der Beigeladenen nicht habe aufgehoben werden dürfen. § 7 Abs. 5 Satz 1 UmwRG begrenzt - soweit einschlägig - den Aufhebungsanspruch des Anfechtenden nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO unter anderem dann, wenn eine Verletzung materieller Rechtsvorschriften durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden kann. Diese Anfechtungskonstellation, in der die Genehmigung (nur) für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt wird, solange der Fehler nicht in einem insoweit auf die Anfechtung hin wiederaufgegriffenen Verfahren geheilt ist, hatte die Klägerin offenbar auch bei dem hier streitgegenständlichen isolierten Antrag auf Durchführung eines ergänzenden Verfahrens vor Augen.
10 Ist nach allem die Auslegung des Klagebegehrens als Anfechtungsklage durch das Oberverwaltungsgericht nicht zu beanstanden, ist die Annahme der erstmaligen Erhebung einer Verpflichtungs- bzw. Bescheidungsklage durch die Stellung der entsprechenden Anträge in der mündlichen Verhandlung und damit nach Ablauf der Klagefrist des § 74 Abs. 2, Abs. 1 Satz 1 VwGO folgerichtig. Dass die ursprünglich allein erhobene Anfechtungsklage den Eintritt der Bestandskraft des angefochtenen (Versagungs-)Bescheids nicht gehindert hätte (vgl. BVerwG, Beschluss vom 9. Juli 2024 - 7 B 2.24 - juris Rn. 5, 7), hat das Oberverwaltungsgericht nicht angenommen. Es hat vielmehr die mit dem zweiten Hilfsantrag aufrechterhaltene Anfechtungsklage mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unstatthaft angesehen. Der Anspruch der Klägerin auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG wird nach allem nicht verletzt.
11 c) Die Ablehnung des Rechtsschutzbedürfnisses für den hilfsweise gestellten Anfechtungsantrag ist unter Zugrundelegung der Rechtsauffassung des Oberverwaltungsgerichts nicht zu beanstanden. Jedenfalls kann das Urteil hierauf nicht beruhen. Selbst wenn die Vorinstanz die Anfechtungsklage für statthaft gehalten hätte, war die Möglichkeit, dass das Gericht zu einem der Klägerin sachlich günstigeren Ergebnis hätte gelangen können, ausgeschlossen. Die Ablehnung der isolierten Durchführung eines ergänzenden Verfahrens nach § 7 Abs. 5 Satz 1 UmwRG durch den Beklagten verletzt die Klägerin offensichtlich nicht in ihren Rechten, weil sie hierauf keinen Anspruch hat. Die Vorschrift gilt nur im gerichtlichen Verfahren. Sie eröffnet dem Gericht die Möglichkeit, die Verpflichtung zu einer Entscheidungsergänzung auszusprechen oder die angegriffene Entscheidung für rechtswidrig und nicht vollziehbar zu erklären. Hat ein Gericht dem Antrag des Drittbetroffenen auf Aufhebung der Genehmigung stattgegeben, kann der Beklagte oder der beigeladene Genehmigungsinhaber gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel mit dem Ziel einlegen, dass die Genehmigung für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt wird, mit der Folge, dass der festgestellte Fehler in einem ergänzenden Verwaltungsverfahren behoben werden könnte (vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Oktober 2008 - 4 C 5.07 - BVerwGE 132, 123 Rn. 73 ff.; Seibert, NVwZ 2018, 97 <103>). Das Bedürfnis einer Anwendung des § 7 Abs. 5 Satz 1 UmwRG im behördlichen Verfahren besteht regelmäßig nicht. Zur näheren Begründung wird auf den Beschluss des Senats vom 5. März 2025 - 7 B 19.24 - (Rn. 12) Bezug genommen.
12 Dies gilt hier umso mehr, als die Klägerin ein selbständiges behördliches Verfahren anstrebt, neben dem Widerspruchsverfahren des Beklagten auf den Rechtsbehelf der Beigeladenen wegen der Ersetzung ihres gemeindlichen Einvernehmens im Rahmen der erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Unabhängig davon ist eine Heilung des im maßgeblichen Zeitpunkt der Genehmigungserteilung rechtswidrig ersetzten gemeindlichen Einvernehmens in einem ergänzenden Verfahren nicht möglich. Nach den Feststellungen der Vorinstanz im Parallelverfahren war die Erschließung des Vorhabens im Zeitpunkt der Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung an die Klägerin nicht ausreichend gesichert. Wegen der deshalb ursprünglich rechtswidrigen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens war der Beklagten die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens mit dem Ziel der nachträglichen Sicherung der Erschließung des Vorhabens auf andere Weise versagt. Wegen der weiteren Begründung wird auf den Beschluss des Senats vom 5. März 2025 - BVerwG 7 B 19.24 - (Rn. 14) verwiesen.
13 2. Liegen die von der Klägerin gerügten Verfahrensfehler demnach nicht vor, kommt ihnen auch nicht die von ihr angenommene grundsätzliche Bedeutung zu.
14
Die von der Klägerin zudem im Hinblick auf § 7 Abs. 5 Satz 1 UmwRG aufgeworfenen Fragen, ob
"das ergänzende Verfahren nur im gerichtlichen Hauptsacheverfahren anwendbar [ist] oder auch bereits im Widerspruchsverfahren?"
und
"es sich bei der unzureichenden Erschließung einer Windenergieanlage um einen Verstoß [handelt], der von solcher Art und Schwere ist, dass er die Identität des Vorhabens als Ganzes berührt und eine Heilung im ergänzenden Verfahren daher in der Regel ausschließt?",
haben schon deshalb keine grundsätzliche Bedeutung, weil sie für das Oberverwaltungsgericht nicht entscheidungstragend waren. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Beschluss des Senats vom 5. März 2025 - BVerwG 7 B 19.24 - (Rn. 17 f.) Bezug genommen.
15 Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 und § 162 Abs. 3 VwGO. Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 i. V. m. § 52 Abs. 1 GKG.