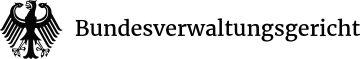Beschluss vom 26.06.2024 -
BVerwG 4 B 2.24ECLI:DE:BVerwG:2024:260624B4B2.24.0
-
Zitiervorschlag
BVerwG, Beschluss vom 26.06.2024 - 4 B 2.24 - [ECLI:DE:BVerwG:2024:260624B4B2.24.0]
Beschluss
BVerwG 4 B 2.24
- VG Würzburg - 28.05.2019 - AZ: W 4 K 17.364 u. a.
- VGH München - 25.10.2023 - AZ: 9 B 22.1461 u. a.
In der Verwaltungsstreitsache hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts
am 26. Juni 2024
durch die Vorsitzende Richterin am Bundesverwaltungsgericht Schipper,
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Decker und
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Stamm
beschlossen:
- Die Beschwerde der Kläger gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 25. Oktober 2023 wird zurückgewiesen.
- Die Kläger tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen als Gesamtschuldner.
- Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwerdeverfahren auf 15 315 € festgesetzt.
Gründe
1 Die auf § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 2 VwGO gestützte Beschwerde der Kläger hat keinen Erfolg. Sie ist jedenfalls unbegründet.
2 I. Die Rechtssache hat nicht die grundsätzliche Bedeutung, die ihr die Beschwerde beimisst.
3 Grundsätzlich bedeutsam im Sinne von § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO ist eine Rechtssache, wenn in dem angestrebten Revisionsverfahren die Klärung einer bisher höchstrichterlich ungeklärten, in ihrer Bedeutung über den der Beschwerde zugrunde liegenden Einzelfall hinausgehenden, klärungsbedürftigen und entscheidungserheblichen Rechtsfrage des revisiblen Rechts (§ 137 Abs. 1 VwGO) zu erwarten ist. In der Beschwerdebegründung muss dargelegt (§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO), also näher ausgeführt werden, dass und inwieweit eine bestimmte Rechtsfrage des revisiblen Rechts im allgemeinen Interesse klärungsbedürftig und warum ihre Klärung in dem beabsichtigten Revisionsverfahren zu erwarten ist (stRspr, vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 2. Oktober 1961 - 8 B 78.61 - BVerwGE 13, 90 <91> und vom 14. Oktober 2019 - 4 B 27.19 - Buchholz 406.11 § 34 BauGB Nr. 225 Rn. 4).
4 Die Kläger wenden sich gegen Bauordnungsverfügungen. Der Verwaltungsgerichtshof ist davon ausgegangen, dass die Festsetzung eines Sondergebietes "Wochenendhausgebiet mit Freizeitbetrieb" im Bebauungsplan "Freizeitfläche S. Änderung 1" Maßstab für die materielle Rechtmäßigkeit der auf dem klägerischen Grundstück errichteten baulichen Anlagen ist. Die Festsetzung sei nicht funktionslos geworden, weil die bestehenden planwidrigen Verhältnisse weder genehmigt seien noch förmlich oder faktisch geduldet würden und sich auch nicht aus anderen tatsächlichen Gründen verfestigt hätten.
5
Im Hinblick hierauf hält die Beschwerde für grundsätzlich klärungsbedürftig,
- wie sich die zum Teil jahrzehntelange Wohnnutzung in dem Wochenendgebiet und die damit einhergehende Meldung als Wohnsitz gegenüber der Meldebehörde auf die Wirksamkeit des Bebauungsplans auswirkt,
- ob das isolierte Einschreiten gegen die baulichen Missstände (auch soweit sie nicht unmittelbar der Durchsetzung des Verbots des Dauerwohnens dienen) geeignet ist, zugleich davon auszugehen, dass der Beklagte auch gegen die stattfindende Dauerwohnnutzung vorgehen wolle,
- ob öffentliche Verlautbarungen (örtliche Presse) der Bauaufsichtsbehörde, gegen Dauerwohnnutzung nicht vorzugehen, genügen, um einen Vertrauenstatbestand zu begründen, der einem in die Fortgeltung der Festsetzung gesetzten Vertrauen die Schutzwürdigkeit nimmt und
- ob die schriftliche Duldung einzelner baulicher Verstöße durch die Bauaufsichtsbehörde (Amnestien), die dem Verbot des Dauerwohnens dienten, zugleich eine Duldung des Dauerwohnens umfasst.
6 Die Fragen rechtfertigten die Zulassung der Revision nicht. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, dass eine bauplanerische Festsetzung funktionslos sein kann, wenn und soweit die tatsächlichen Verhältnisse, auf die sie sich bezieht, ihre Verwirklichung auf unabsehbare Zeit ausschließen und diese Tatsache so offensichtlich ist, dass ein in ihre Fortgeltung gesetztes Vertrauen keinen Schutz verdient (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. März 2023 - 4 A 9.21 - juris Rn. 39 m. w. N.). Dafür genügt es nicht schon, dass über längere Zeit von dem Plan abgewichen worden ist und inzwischen Verhältnisse entstanden sind, die den Festsetzungen des Plans nicht entsprechen (BVerwG, Urteil vom 3. August 1990 - 7 C 41.89 u. a. - BVerwGE 85, 273 <281>). Insbesondere eine derzeitige planwidrige Nutzung - von der der Verwaltungsgerichtshof hier angesichts der durch die Anmeldung von Hauptwohnsitzen belegten Dauerwohnnutzung ausgegangen ist - schließt als solche die in die Zukunft gerichtete städtebauliche Gestaltungs- und Steuerungsfunktion des Bebauungsplans nicht aus. Eine solche Nutzung kann auch im Falle melderechtlicher Hauptwohnsitze mit den Mitteln des Bauordnungsrechts beendet werden, sodass die bloße Passivität der Baurechtsbehörde nicht ausreicht. Eine offenkundige Abweichung vom Planinhalt ist in der Regel nur dann gegeben, wenn die den Festsetzungen entgegenstehende Wohnnutzung durch eine Baugenehmigung rechtlich gesichert ist oder in einer Weise geduldet wird, die keinen Zweifel daran lässt, dass die zuständige Behörde sich mit ihrem Vorhandensein (endgültig) abgefunden hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. März 2023 - 4 A 9.21 - juris Rn. 41 m. w. N.). Weitergehenden grundsätzlichen Klärungsbedarf zeigt die Beschwerde nicht auf. Ihr geht es vielmehr um die Klärung, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die in den "Grundsatzfragen" bezeichneten Umstände auf eine funktionslose Festsetzung eines Bebauungsplans schließen lassen. Diese Fragen lassen sich indessen nicht abstrakt beantworten. Sie verlangen eine Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalls, die den Tatsachengerichten vorbehalten ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 17. Februar 1997 - 4 B 16.97 - Buchholz 406.11 § 10 BauGB Nr. 34 S. 5).
7 II. Mit der Divergenzrüge dringt die Beschwerde ebenfalls nicht durch.
8 Gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO ist die Revision zuzulassen, wenn das Urteil von einer Entscheidung (u. a.) des Bundesverwaltungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht. Dies setzt einen Widerspruch in einem abstrakten Rechtssatz voraus, also einen prinzipiellen Auffassungsunterschied über den Bedeutungsgehalt einer bestimmten Rechtsvorschrift oder eines Rechtsgrundsatzes (BVerwG, Beschluss vom 21. Dezember 2017 - 6 B 43.17 - Buchholz 421.2 Hochschulrecht Nr. 198 Rn. 4). In der Beschwerdebegründung muss nach § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO die Entscheidung bezeichnet werden, von der das Urteil abweicht. Der Beschwerde obliegt es, einen tragenden, abstrakten Rechtssatz dieser Entscheidung zu einer revisiblen Rechtsvorschrift zu benennen und darzulegen, dass die Entscheidung der Vorinstanz auf einem abweichenden abstrakten Rechtssatz zu derselben Rechtsvorschrift beruht. Für eine Abweichung nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO genügt nicht der Vorwurf, die Vorinstanz habe einen abstrakten Rechtssatz des Bundesverwaltungsgerichts fehlerhaft oder gar nicht angewandt (stRspr, vgl. BVerwG, Beschluss vom 23. November 2022 - 4 BN 4.22 - juris Rn. 11 m. w. N.). Gemessen daran legt die Beschwerde eine Divergenz nicht dar.
9 Die Beschwerde entnimmt dem Urteil des Senats vom 28. April 2004 - 4 C 10.03 - (Buchholz 406.12 § 3 BauNVO Nr. 15 S. 5) den Rechtssatz, der bloße Umstand, dass eine Rückkehr zur plankonformen Nutzung rein bautechnisch nicht ausgeschlossen und damit theoretisch durchaus möglich erscheint, reiche nicht aus, um von einer weiteren Wirksamkeit der betreffenden Festsetzung eines Bebauungsplans auszugehen. Eine diesem Rechtssatz widersprechende Aussage kann dem angefochtenen Urteil jedoch nicht entnommen werden und wird von der Beschwerde auch nicht konkret benannt. Der Verwaltungsgerichtshof hat die fortdauernde Wirksamkeit der Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung nicht allein aus der theoretischen Möglichkeit der Rückkehr zu plankonformen Verhältnissen abgeleitet. Er ist vielmehr auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung der Umstände des Einzelfalls zu dem Ergebnis gelangt, dass der Bebauungsplan seine Steuerungsfunktion hinsichtlich der Festsetzung eines Wochenendhausgebiets nicht verloren hat.
10 Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2, § 159 Satz 2, § 162 Abs. 3 VwGO. Die Festsetzung des Streitwerts folgt aus § 47 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 1 GKG.