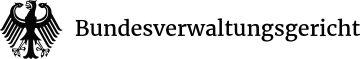Beschluss vom 09.01.2024 -
BVerwG 5 PB 5.23ECLI:DE:BVerwG:2024:090124B5PB5.23.0
-
Zitiervorschlag
BVerwG, Beschluss vom 09.01.2024 - 5 PB 5.23 - [ECLI:DE:BVerwG:2024:090124B5PB5.23.0]
Beschluss
BVerwG 5 PB 5.23
- VG Dresden - 12.10.2021 - AZ: 9 K 1642/19.PL
- OVG Bautzen - 14.10.2022 - AZ: 9 A 734/21.PL
In der Personalvertretungssache hat der 5. Senat des Bundesverwaltungsgerichts
am 9. Januar 2024
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Störmer,
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Harms und
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Preisner
beschlossen:
Die Beschwerden des Antragstellers und des Beteiligten gegen die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde in dem Beschluss des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 14. Oktober 2022 werden verworfen.
Gründe
1 Die Nichtzulassungsbeschwerden des Antragstellers (1.) und des Beteiligten (2.) bleiben erfolglos, weil sie einen Zulassungsgrund nicht in einer den Darlegungsanforderungen entsprechenden Weise aufzeigen.
2 1. Die auf die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache gestützte Beschwerde des Antragstellers hat keinen Erfolg.
3 a) Grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 88 Abs. 2 Satz 1 SächsPersVG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG kommt einer Rechtsfrage nur zu, wenn mit ihr eine für die erstrebte Rechtsbeschwerdeentscheidung erhebliche Frage aufgeworfen wird, die im Interesse der Einheit und Fortbildung des Rechts der Klärung bedarf. Die Rechtsfrage muss zudem klärungsfähig sein, was der Fall ist, wenn sie in der Rechtsbeschwerdeinstanz beantwortet werden kann. Das Darlegungserfordernis des § 88 Abs. 2 Satz 1 SächsPersVG i. V. m. § 92a Satz 2 i. V. m. § 72a Abs. 3 Satz 1 und 2 Nr. 1 ArbGG setzt die Formulierung einer bestimmten, höchstrichterlich noch ungeklärten und für die Rechtsbeschwerdeentscheidung erheblichen Rechtsfrage sowie die Angabe voraus, worin die allgemeine, über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung besteht (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 28. Juli 2014 - 5 PB 1.14 - juris Rn. 4 und vom 25. Mai 2016 - 5 PB 21.15 - juris Rn. 10 m. w. N.). Die Begründungspflicht verlangt, dass sich die Beschwerde mit den Erwägungen des angefochtenen Beschlusses, auf die sich die aufgeworfene Frage von angeblich grundsätzlicher Bedeutung bezieht, substanziiert auseinandersetzt. Es bedarf auch der substanziierten Auseinandersetzung mit den Gründen bereits ergangener einschlägiger Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Soweit sich die Vorinstanz mit der von der Beschwerde als grundsätzlich angesehenen Frage beschäftigt hat, gehört zu der erforderlichen Durchdringung des Prozessstoffes die Erörterung sämtlicher Gesichtspunkte, die im Einzelfall für die erstrebte Zulassung der Rechtsbeschwerde rechtlich Bedeutung haben können. In der Begründung ist auch substanziiert aufzuzeigen, aus welchen Gründen der Rechtsauffassung, die der aufgeworfenen Frage von angeblich grundsätzlicher Bedeutung zugrunde liegt, zu folgen ist (stRspr, vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 20. September 2018 - 5 PB 8.18 - juris Rn. 3 m. w. N.). Diesen Anforderungen genügt die Beschwerde mit der von ihr aufgeworfenen Frage und der dazu vorgebrachten Begründung nicht.
4
Die Beschwerde hält die Rechtsfrage für grundsätzlich bedeutsam,
"ob das Einsichtsrecht des Personalrats in schriftliche Angaben zu den Bruttoentgelten der von ihm vertretenen Beschäftigten für die Beschäftigten ausgeschlossen ist, die ein verstetigtes monatliches außertarifliches Bruttoentgelt sowie weitere außertarifliche Vergütungsbestandteile erhalten."
5
Sie zeigt jedoch die Entscheidungserheblichkeit und damit die Klärungsbedürftigkeit der aufgeworfenen Frage nicht in einer den Darlegungsanforderungen genügenden Weise auf. Es ist bereits nicht dargelegt, dass sich die Frage in dieser (allgemeinen) Form dem Oberverwaltungsgericht gestellt hat und sich in einem Rechtsbeschwerdeverfahren stellen wird. Das gilt schon deshalb, weil Gegenstand des Verfahrens, über den das Oberverwaltungsgericht zu entscheiden hatte und der im Falle einer (Teil-)Zulassung in das Rechtsbeschwerdeverfahren übergehen würde, nur der streitige, von den Vorinstanzen abgelehnte Antrag ist, der allein die Frage umfasst, ob dem Antragsteller ein Anspruch auf Verpflichtung des Beteiligten zusteht,
"dem Vorsitzenden des Antragstellers oder dessen Stellvertreter oder einem anderen vom Antragsteller beauftragten Mitglied des Antragstellers jederzeit Einblick in schriftliche Angaben zu den von ihm vertretenen Beschäftigten der S. wie folgt zu gewähren:
• Wer bezieht in welcher Höhe ein außertarifliches monatliches Entgelt?
und
• Welchem außertariflich Vergüteten wird welche Zulage/welcher Zuschlag/welche Prämie usw. wofür und in welcher Höhe bezahlt?".
6 Da sich der Antrag auf die Geltendmachung eines "jederzeitigen" Einsichtsrechts bezieht, ist weder dargelegt noch sonst erkennbar, dass sich die diese Einschränkung nicht enthaltende, als grundsätzlich bedeutsam aufgeworfene Frage in der von der Beschwerde formulierten allgemeinen Form so stellen wird und vom Rechtsbeschwerdegericht zu klären wäre. Das gilt auch deshalb, weil es verfahrensgegenständlich - anders als in der von der Beschwerde aufgeworfenen Frage - darum geht, ob ein solches Einsichtsrecht im Hinblick auf außertariflich Beschäftigte auf der Grundlage welcher personalvertretungsrechtlichen Regelung überhaupt in welchem Umfang besteht und nicht darum, wann es ausgeschlossen ist.
7 Selbst wenn der Antragsteller die Frage - insbesondere mit Blick auf das Bestehen eines "jederzeitigen" Einsichtsrechts - in einer auf den Verfahrensgegenstand bezogenen und gegebenenfalls klärungsfähigen Weise aufgeworfen hätte bzw. die Frage im Wege der Auslegung zugunsten des Antragstellers entsprechend zu fassen wäre, genügte die Beschwerde nicht den Anforderungen an die Darlegung der Grundsatzbedeutung. Sie zeigte dann jedenfalls nicht substanziiert auf, aus welchen Gründen die so verstandene Rechtsfrage in dem vom Antragsteller vertretenen Sinne bejahend zu beantworten wäre, weil sie sich insbesondere nicht genügend mit der (ihrer Auffassung gegebenenfalls entgegenstehenden) einschlägigen Rechtsprechung auseinandersetzt. Die Beschwerde (Beschwerdebegründung S. 7 f.) beruft sich für das Bestehen eines von ihr angenommenen Einsichtsrechts der Personalvertretung im Hinblick auf Entgelte und Zulagen außertariflich Beschäftigter zwar maßgeblich auf eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zu § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 BetrVG, welches mit Beschluss vom 14. Januar 2014 - 1 ABR 54/12 - entschieden habe, dass "dem Betriebsrat Einsicht in die Bruttolohn- und -gehaltslisten der Arbeitnehmer mit Ausnahme der leitenden Angestellten [...] hinsichtlich sämtlicher Vergütungsbestandteile zu gewähren" sei. Unabhängig davon, dass die Beschwerde nicht aufzeigt, ob und inwieweit dieser Entscheidung zum Betriebsverfassungsrecht unmittelbare Bedeutung und Aussagekraft für die Auslegung der vom Oberverwaltungsgericht herangezogenen und als Anspruchsgrundlage allein in Betracht kommenden personalvertretungsrechtlichen Regelung (§ 73 Abs. 2 SächsPersVG) zukommen soll, nimmt sie unter anderem die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht in den Blick, die der Annahme eines "jederzeitigen" Einsichtsrechts entgegenstehen könnte. Denn zu dem Anspruch des Betriebsrats auf Einblick in Listen über Bruttolöhne und -gehälter gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 BetrVG hat das Bundesarbeitsgericht in seinem Beschluss vom 29. September 2020 ausgeführt, dass dieser Anspruch eine auf das konkrete Einsichtsverlangen bezogene, spezifische Prüfung der Erforderlichkeit für die vom Betriebsrat geltend gemachten Aufgaben verlangt, die (auch) durch die Argumentation nicht ersetzt werden kann, das Verlangen einer Einblicknahme könne "jederzeit" angebracht werden (BAG, Beschluss vom 29. September 2020 - 1 ABR 23/19 - AP BetrVG 1972 § 80 Nr. 90 Rn. 19 ff. mit Bestätigung der Entscheidung der Vorinstanz, LAG Kiel, Beschluss vom 23. Mai 2019 - 5 TaBV 9/18 - juris, wonach der Betriebsrat von der Arbeitgeberin nicht von vornherein ohne gesonderte eigene Prüfung der Erforderlichkeit wiederkehrend die monatliche Einsichtnahme verlangen könne). Insoweit setzt sich die Beschwerde auch nicht mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Personalvertretungsrecht auseinander, wonach die Unterrichtungs- bzw. Informationspflicht der Dienststellenleitung und damit die Verpflichtung zur Gewährung von Einsichtnahme in Unterlagen oder deren Vorlage nur in dem Umfang besteht, in welchem die Personalvertretung deren Kenntnis zur Durchführung einer ihrer Aufgaben benötigt (stRspr, vgl. z. B. BVerwG, Beschlüsse vom 22. April 1998 - 6 P 4.97 - NZA-RR 1999, 274 <274 f.> und vom 19. Dezember 2018 - 5 P 6.17 - BVerwGE 164, 146 Rn. 16 m. w. N.), die sie jeweils mit dem konkreten Einsichtnahmebegehren gegenüber der Dienststellenleitung in Bezug genommen hat. Überdies setzt sich die Beschwerde weder mit den dem Einsichtsrecht des Antragstellers gegebenenfalls entgegenstehenden Aspekten des aktuellen Datenschutzrechts (s. dazu BAG, Beschluss vom 7. Mai 2019 - 1 ABR 53/17 - AP BetrVG 1972 § 80 Nr. 87) auseinander noch geht sie auf die Rechtsprechung des Senats ein, wonach der Personalrat in Angelegenheiten, in denen seine Mitbestimmung nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz in bestimmten Personalangelegenheiten ausgeschlossen ist, die Unterrichtung und Vorlage von Unterlagen nicht auf sein allgemeines Wächteramt stützen kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 29. September 2020 - 5 P 11.19 - BVerwGE 169, 279). Letzteres wäre veranlasst gewesen, weil die Beschwerde (Beschwerdebegründung S. 9) hinsichtlich der im Streit stehenden Gruppe der außertariflich Beschäftigten gerade unter Hinweis auf allgemeine Überwachungsaufgaben der Personalvertretung geltend macht, dass dieser ein Recht auf Einsicht in schriftliche Angaben zustehen müsse, das die namentliche Nennung aller außertariflich Beschäftigten erfasse und sich auf deren (individuell ausgehandelte) Bruttoentgelte sowie weitere außertarifliche Vergütungsbestandteile erstrecke.
8 b) Von einer weiteren Begründung wird nach § 88 Abs. 2 Satz 1 SächsPersVG i. V. m. § 92a Satz 2 i. V. m. § 72a Abs. 5 Satz 5 Alt. 1 ArbGG abgesehen.
9 2. Die Beschwerde des Beteiligten, die auf die Rüge eines Verstoßes gegen § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO und eine darin zugleich liegende Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß Art. 103 Abs. 1 GG gestützt ist, hat ebenfalls keinen Erfolg.
10 a) Der Beteiligte rügt, das Oberverwaltungsgericht habe im Beschwerdeverfahren "über einen vom Antragsteller tatsächlich nicht (mehr) gestellten Antrag entschieden", indem es "mit seinem Beschluss die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden [...] aufrechterhalten" habe, was in der Beschlussformel des Oberverwaltungsgerichts mit der Wendung "... soweit das Verwaltungsgericht die Anträge abgewiesen hat ..." zum Ausdruck gekommen sei. Darin liege ein Verstoß gegen den Grundsatz der Bindung an die Anträge des Antragstellers gemäß § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO, der sich als Verstoß gegen den Anspruch des Beteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs darstelle.
11 Mit diesem und weiterem Vorbringen zeigt die Beschwerde einen entsprechenden Verfahrensfehler in Gestalt eines Gehörsverstoßes nicht auf. Sie genügt nicht den Anforderungen des § 88 Abs. 2 Satz 1 SächsPersVG i. V. m. § 92a Satz 2 und § 72a Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 Alt. 2 ArbGG, wonach in der Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde die Verletzung des Verfahrensrechts und deren Entscheidungserheblichkeit darzulegen und die Voraussetzungen des Zulassungsgrundes substanziiert aufzuzeigen sind (stRspr, vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 13. Januar 2022 - 5 PB 9.21 - juris Rn. 2 m. w. N. und vom 16. Juni 2022 - 5 PB 18.21 - NZA-RR 2022, 604 Rn. 17).
12 Zwar kann in einem Verstoß gegen die Verfahrensregelung des § 308 Abs. 1 ZPO, der im Rahmen des personalvertretungsrechtlichen Verfahrens der Nichtzulassungsbeschwerde grundsätzlich nicht isoliert rügefähig ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 24. Januar 2019 - 5 PB 4.18 - juris Rn. 6), dann ein beachtlicher Verfahrensfehler (im Sinne von § 72a Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ArbGG) liegen, wenn sich der Verstoß zugleich als Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt. Dies kann auch anzunehmen sein, wenn das Gericht zum Nachteil eines Beteiligten über einen Antrag entscheidet, den der Kläger bzw. Antragsteller nicht (mehr) gestellt hat (vgl. BAG, Beschluss vom 21. Juli 2022 - 2 AZN 801/21 - AP ZPO § 308 Nr. 10 Rn. 6; BGH, Beschlüsse vom 13. September 2016 - VII ZR 17/14 - NJW 2017, 1180 Rn. 13 und vom 16. Mai 2017 - VI ZR 25/16 - NJW 2017, 2561 Rn. 11, jeweils m. w. N.). Aus dem Vorbringen der Beschwerde ergibt sich jedoch nicht, dass das Oberverwaltungsgericht über einen Antrag entschieden hat, der vom Antragsteller im Beschwerdeverfahren nicht mehr verfolgt worden ist.
13 Der Antragsteller hat - wie auch die Beschwerde einräumt – "ausweislich des Anhörungstermins vom 14. Oktober 2022 beantragt, den Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden vom 12. Oktober 2021 zu ändern, soweit das Verwaltungsgericht die Anträge (also Haupt- und Hilfsantrag) abgewiesen hat" (Beschwerdebegründung S. 6). Durch diese Antragsfassung hat er zunächst deutlich gemacht, dass er den bisherigen Teilerfolg beim Verwaltungsgericht nicht zur Disposition stellen wollte und insoweit nur eine Änderung dieser Entscheidung begehrte. Zugleich hat der Antragsteller, indem er seinen bereits beim Verwaltungsgericht gestellten Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren wiederholt und erneut zur Entscheidung gestellt hat, erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass er (für den Fall der Ablehnung des Hauptantrags durch das Oberverwaltungsgericht) eine für ihn günstigere Entscheidung hinsichtlich aller Bestandteile des beim Verwaltungsgericht nur teilweise erfolgreichen Hilfsantrags erstrebte. Das Oberverwaltungsgericht hatte daher - wie der Beteiligte ebenfalls erkennt - zunächst über den vom Verwaltungsgericht abgelehnten Hauptantrag und sodann - nachdem es die diesbezügliche Ablehnungsentscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigte - über den im Termin zur Anhörung am 14. Oktober 2022 weiter aufrechterhaltenen Hilfsantrag des Antragstellers zu entscheiden. Dies hat das Oberverwaltungsgericht entgegen der Ansicht der Beschwerde auch getan. Der Beteiligte irrt, soweit er annimmt, das Oberverwaltungsgericht habe mit der teilweisen Stattgabe der Beschwerde des Antragstellers mit der Wendung "soweit das Verwaltungsgericht die Anträge abgewiesen hat" den "Teil des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Dresden, mit dem dem Hilfsantrag des Antragstellers teilweise stattgegeben wurde", (vollständig) "aufrechterhalten" (Beschwerdebegründung S. 7 f.). Das Oberverwaltungsgericht hat mit dieser Tenorierung vielmehr zum Ausdruck gebracht, dass es die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zugunsten des Antragstellers ändert, soweit das Verwaltungsgericht hinter dem zurückgeblieben ist, was der Antragsteller mit dem Hilfsantrag (erster und zweiter Punkt) begehrt hat. Dies hat es auch in den Gründen seines Beschlusses, die zur Auslegung der Urteils- bzw. Beschlussformel ergänzend heranzuziehen sind (vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 21. September 1984 - 8 C 4.82 - BVerwGE 70, 159 <161> m. w. N.), unmissverständlich deutlich gemacht. So hat es bereits eingangs der Gründe (II.) ausgeführt, dass die zulässige Beschwerde des Antragstellers "im tenorierten Umfang Erfolg" habe und das Verwaltungsgericht "den Antrag des Antragstellers insoweit zu Unrecht als unbegründet angesehen" habe. Dem Antragsteller stehe ein Recht auf die Verpflichtung zu, seinem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter oder einem anderen von ihm beauftragten Mitglied jederzeit Einsicht in schriftliche Angaben zu den von ihm vertretenen Beschäftigten der S. im tenorierten Umfang zu gewähren. Dass das Oberverwaltungsgericht über die Teilstattgabe des Hilfsantrags (erster und zweiter Punkt) durch das Verwaltungsgericht, die sich zugleich als Teilablehnung darstellte, hinausgehen wollte und den Beschluss des Verwaltungsgerichts zugunsten des Antragstellers geändert hat, soweit dieses den Antrag abgelehnt hat, hat das Oberverwaltungsgericht überdies in den weiteren Gründen der Entscheidung (BA Rn. 39) deutlich gemacht, wo es heißt: "Hiervon ausgehend ist der Senat abweichend von der Auffassung des Verwaltungsgerichts der Überzeugung, dass auch Informationen über die konkrete Höhe der Vergütung einzelner Beschäftigter vom Informationsanspruch des Antragstellers mitumfasst sind [...]".
14 b) Von einer weiteren Begründung wird nach § 88 Abs. 2 Satz 1 SächsPersVG i. V. m. § 92a Satz 2 i. V. m. § 72a Abs. 5 Satz 5 Alt. 1 ArbGG abgesehen.